Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Hans-Peter Schwarz - Helmut Kohl
06.07.2025 um 13:07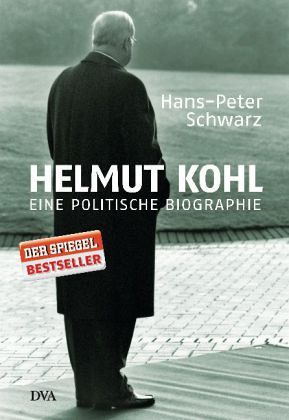
Mit fast 80 Jahren hat der Historiker Hans-Peter Schwarz 2012 eine tausendseitige Biographie von Helmut Kohl vorgelegt, die keine Hagiographie, also keine Heiligenbeschreibung, ist, sondern sprachmächtig ein halbes Jahrhundert deutsche und europäische Politik vor Augen führt. Der komplette Lebensweg Kohls ist in die nationale wie internationale politische Lage eingebettet, was dieses Buch zu einer faszinierenden Lektüre macht.
Schwarz betont, dass Kohl aufgrund seiner Herkunft schon früh von Adenauer geprägt war, obwohl er noch als Kind die Hitlerjugend "durchgemacht" hat. Seine Grundprinzipien waren durchgehend: Freundschaft mit Frankreich, europäische Integration mit dem Ziel eines europäischen Bundesstaats, transatlantisches Sicherheitsbündnis, freundschaftliche Beziehungen zur Sowjetunion bzw. zu Russland, Kontakt zu China, soziale Marktwirtschaft mit Fokus auf Sozialem. Und wie ein Damoklesschwert hängt die Angst, dass Deutschland Kampfzone bei einem Dritten Weltkrieg werden könnte, über seinem Kopf, was viele Entscheidungen der 1980er Jahre bezüglich Sicherheitspolitik beeinflusst.
Kohls Ideen bezüglich der Entwicklung der EG/EU: Am Herzen liege ihm
ein von allen Bürgern zu wählendes Parlament, das umfassende parlamentarische Gesetzgebungs- und Kontrollrechte hat, eine europäische Regierung, die allein diesem Parlament verantwortlich ist, eine europäische Staatenkammer, die den Mitgliedstaaten die Beteiligung an der Gesetzgebung des Bundes ermöglicht, ein europäischer Gerichtshof, der die Auslegung und Anwendung der europäischen Rechtsprechung überwacht.Kohl zum Thatcherismus:
Ich bin kein Anhänger der Marktwirtschaft, sondern der Sozialen Marktwirtschaft! Ich glaube nicht an jenes Stück Vorstellung von Liberalismus – ich will jetzt nicht das Wort Manchester-Liberalismus sagen –, daß der Reichtum einer ganzen Gruppe automatisch übergreift und immer weiter übergreift und dadurch die Schwachen hochzieht.Sein Lebensweg sei typisch für viele Kanzler der Bundesrepublik: Abstammung aus einfachen familiären Verhältnissen, Parteikarriere. Als Kind und Jugendlicher sei Kohl laut gewesen und habe auch vor Prügeleien nicht zurückgeschreckt. So werde er sich in der CDU auf vielen Parteiebenen durchsetzen (Rheinland-Pfalz, das unter ihm modernisiert wird, schließlich im Bund). Und das alles liest sich wie ein Polit-Thriller, wobei ich seinen Parteiaufstieg bzw. die Ränke um die Koalition mit der FDP nicht nachzeichnen möchte. Auf jeden Fall riskiert er bei der Durchsetzung des politischen Willens, aber auch seiner Machtposition auch Freundschaften.
Ein Thriller der Sonderklasse ist der Zusammenbruch der DDR. Ausgangspunkt für Kohls Politik dürfte sein Treffen mit Gorbatschow im Juni 1989 gewesen sein (Ungarn baut schon Grenzzäune zu Österreich ab und hat im Februar 1989 beschlossen, ein pluralistisches System einzuführen). Im gemeinsamen Protokoll des Treffens steht zu lesen:
Das Recht aller Völker und Staaten, ihr Schicksal frei zu bestimmen und ihre Beziehungen auf der Grundlage des Völkerrechts souverän zu bestimmen, muß sichergestellt werden.Das Zeitfenster einer sowjetischen Nichteinmischung ist geöffnet. Dies ist mit ein Grund, warum Kohl Gorbatschow nicht nur umhätschelt, sondern die marode sowjetische Wirtschaft mit Milliardenbeträgen unterstützt. Ein Sturz des in der Sowjetunion nicht unumstrittenen Gorbatschow könnte das Zeitfenster schließen, und in der DDR sind Hunderttausende Sowjetsoldaten stationiert.
Bezüglich Kohls Grundsätzen zu einer Vereinigung schreibt Schwarz:
keine Einheit um den Preis der Neutralität, keine Einheit um den Preis der europäischen Integration und keine Einheit um den Preis der Zugehörigkeit zur NATOAuf Basis dieser Grundsätze ist Kohl nach dem Fall der Berliner Mauer klar, dass ein Beitritt der Länder der DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes und nicht über eine neue Verfassung gemäß Artikel 146 zu erfolgen habe. Durch ein Beitrittsansuchen wäre auch Gorbatschows Bedingung, dass der Wille "der Deutschen in beiden deutschen Staaten" zu berücksichtigen ist, respektiert. Bezüglich NATO-Mitgliedschaft sichert Kohl zu, dass keine der NATO unterstellten Einheiten auf dem Territorium der ehemaligen DDR stationiert würden.
Auf eine mögliche Vergrößerung Deutschlands reagieren vor allem Frankreich und Großbritannien heftig. Mitterand, zu dem Kohl ein freundschaftliches Verhältnis pflegt, droht mit dem Wiedererstehen der Entente des Ersten Weltkriegs und Krieg, wenn die deutsche Einigung vor einer Einigung Europas stattfinde:
Falls sich die deutsche Vereinigung in einem Europa vollziehen sollte, das letztlich nicht entscheidend weitergekommen sei, dann würden die europäischen Partner, die sich in Zukunft achtzig Millionen Deutschen gegenübersähen, wohl nach einem Gegengewicht suchen. Entweder erfolgt die deutsche Einheit nach der europäischen Einheit, oder Ihr werdet Euch einer Tripelallianz (Frankreich, Großbritannien, Rußland) gegenübersehen, und das wird mit einem Krieg enden. Wenn sich aber die deutsche Einheit nach der von Europa vollzieht, werden wir Euch helfen.Mitterand und Gorbatschow setzen sich bei einem Treffen in Kiew am 6. Dezember 1989 für eine Stabilisierung der DDR ein, um das Vereinigungsprojekt Kohls zu durchkreuzen. Eine Währungsunion in Europa und die Stärkung der KSZE seien zu fördern, die Grenzen der DDR sollen bestätigt werden.
Margaret Thatcher hat weniger in die Waagschale zu werfen als Mitterand, aber ihr Ausruf beim Straßburger EG-Gipfel am 8. Dezember 1989 ist von einer ihr typischen Prägnanz:
Zweimal haben wir die Deutschen geschlagen! Jetzt sind sie wieder da!Thatcher und Mitterand setzen sich bei diesem Gipfel mehrfach zusammen und wollen den alliierten Kontrollrat reaktivieren. Doch da spielen die USA unter George H. Bush nicht mit, für den ein vergrößertes Deutschland kein Problem ist.
Am 20. Januar 1990 setzen sich Thatcher und Mitterand wieder zusammen und wollen wegen der offenen Grenzfrage zu Polen die Entente Cordiale wiederbeleben. Doch mittlerweile hat Gorbatschow zu 2+4-Verhandlungen eingelenkt, auf deren Zug nun Thatcher und Mitterand aufspringen (müssen). Mitterand fordert die Einbeziehung Polens in diese Verhandlungen, und eine Zusage der Respektierung der Oder-Neiße-Linie seitens Kohl und Genscher reicht ihm nicht. Nun schwebt ihm auch die Wiedererrichtung der Kleinen Entente zwischen Frankreich und Polen vor.
Auch in dieser Frage läuft sich Mitterand fest. Bush sieht das alles nicht so kritisch und Gorbatschow setzt auf eine Wirtschaftshilfe seitens der USA und Deutschlands. Dem kann Frankreich nichts entgegensetzen.
Die Volkskammerwahl in der DDR am 18. März 1990 setzt einen Schlussstrich. Die DDR wird nach einer Währungs- und Wirtschaftsunion der Bundesrepublik beitreten (Beschluss am 22./23. August 1990). Mitterand ändert seine Politik und forciert nun den Umbau der EG zu einer politischen Union mit einer gemeinsamen Währung. EU und Euro sind auf dem Weg, denn:
Kohl ist seit seiner Jugend Internationalist und Europäer im Sinne eines Richard Coudenhove-Kalergi sowie von einer ewigen Partnerschaft Deutschlands mit Frankreich überzeugt, denn nur so könne der Frieden in Europa gesichert sein. Deutsche Machtpolitik wie im Kaiserreich oder gar im NS-Reich ist ihm zutiefst ein Gräuel. So ist es zu verstehen, dass er in den 1990er Jahren gegen Widerstände in Politik (auch in CDU/CSU), Wirtschaftswissenschaft und Bevölkerung die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung forciert.
Hintergrund: Mitterand drängt seit Langem auf eine Politisierung der EG und sein Hauptziel sei die Brechung der Stärke der D-Mark durch Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung. Kohls Wunsch, dass es auch eine Verteidigungspartnerschaft geben solle, bei der Frankreich Deutschland unter den Schutz der französischen Atomwaffen stellt, wird von Mitterand abgeschmettert.
Zwar syntaktisch durch eine Frage abgemildert, aber deutlich stellt Schwarz fest,
daß der bislang gleichfalls europäische, in Maßen deutschfreundliche Mitterrand zwischen Oktober 1989 und April 1990 förmlich von der Rolle geraten ist und ziemlich orientierungslos viele Hacken geschlagen hat – Absprung vom deutsch-französischen Tandem, zeitweiliges, zugleich aber perspektivloses Zusammengehen mit Gorbatschow, Aufwertung des moribunden SED-Regimes in der DDR, nicht voll durchdachtes Insistieren auf dem Datum einer Regierungskonferenz, unerwartete Bemühung um Wiederbelebung der Entente cordiale ausgerechnet mit der bisherigen Gegnerin Margaret Thatcher, Traum von einer paneuropäischen Konföderation und schließlich Rückkehr aufs deutsch-französische Tandem, allerdings mit dauerhaft geschwächter PositionTiefergehend fährt er fort:
Über Mitterrands Außen- und Europapolitik in dieser Umbruchperiode wird auch künftig noch viel gerätselt und gestritten werden. In mancherlei Hinsicht weist sie in diesem Zeitraum vielleicht doch eine gewisse Konsistenz auf. Sein Verhältnis zu Deutschland ist durchgehend von Ambivalenz gekennzeichnet. Das Europäertum dieses opportunistischen Sozialisten ist viel gaullistischer eingefärbt, als er zugeben möchte. Er wünscht eine enge Entente mit Deutschland, wie sie einstmals de Gaulle zu Zeiten der Kanzlerschaft Adenauers betrieben hat, allerdings unter freundschaftlicher Führung Frankreichs, um den Einfluß der USA zu reduzieren. Gaullistisch bei Mitterrand ist auch das Insistieren auf dem überlegenen Status Frankreichs als Kernwaffenmacht, als eine der vier Siegermächte, als Großmacht in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten, auch als Führungsmacht Westeuropas gegenüber der Sowjetunion. Das gedankliche Spiel, notfalls mit der Sowjetunion gegen eine unruhige Bundesrepublik zusammenzugehen, ist Mitterrand genauso wenig fremd wie de Gaulle. Nur war dieser noch nicht auf die Idee verfallen, die wirtschaftliche Überlegenheit der Bundesrepublik durch Europäisierung der D-Mark zu reduzieren. Auch de Gaulle hat wie Mitterrand die Wiedervereinigung Deutschlands für das natürliche Geschick des deutschen Volkes gehalten, jedoch irgendwann in einer fernen Zukunft, zu französischen Bedingungen und unter strikter Respektierung der Oder-Neiße-Grenze.Dass Kohl die Wiedervereinigung durchgezogen hat, interpretiert Schwarz folgendermaßen:
ohne den Rückhalt der USA hätte Kohl seine improvisierte Wiedervereinigungspolitik nicht riskieren und in kürzester Zeit durchziehen können.Auch Bush haut nun auf den Tisch und lässt Mitterand, Thatcher, zum Teil auch Gorbatschow auflaufen. Am 10. Februar 1990 fliegen Kohl und Genscher nach Moskau.
Die meisten der großen Wendepunkte während der berühmten 329 Tage zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 lassen dies erkennen. Es ist kaum vorstellbar, daß der prinzipiell eher vorsichtige, methodisch vorgehende Helmut Kohl die Kühnheit aufgebracht hätte, kurz vor dem Gipfel zwischen Bush und Gorbatschow in Malta sein Zehn-Punkte-Programm mit dem Endziel der staatlichen Einheit vorzulegen, wäre er sich der Zustimmung Bushs nicht sicher gewesen. Gorbatschow seinerseits protestiert zwar sehr verärgert, aber doch nicht mit letzter Entschiedenheit gegen die Einmischung Kohls in die inneren Angelegenheiten der DDR, weil er bei diesem ersten Treffen nach Bushs Amtsantritt die jahrelange Entspannungspolitik mit den USA nicht gefährden will.
Kurz bevor Kohl zu den Verhandlungen nach Moskau fliegt, wo ihm Generalsekretär Gorbatschow »grünes Licht« für die Einigung Deutschlands geben wird, erhält er ein Schreiben des Präsidenten Bush, in dem sich dieser ausdrücklich verpflichtet, jedem Verzögerungsmanöver der Sowjetunion unter Berufung auf die Rechte der Vier Mächte entgegenzutreten.Kohl und Genscher wissen jedoch auch mittlerweile, dass sowohl die DDR (Arbeitsproduktivität bei 20 Prozent der BRD), aber auch die Sowjetunion wirtschaftlich am Ende sind.
Als Kohl auf dem Flughafen Scheremetjewo eintrifft, überbringt Botschafter Klaus Blech einen Brief Bakers. Gorbatschow und Schewardnadse, so Baker, akzeptierten nun die Wiedervereinigung als »unvermeidlich«. Baker skizziert dann die Erwartungen für die »äußeren Aspekte« der deutschen Einheit und teilt mit, er habe die im State Department ersonnene und mit Genscher schon vorerörterte Formel der »2+4-Gespräche« entriert und auf der Mitgliedschaft Deutschlands in der NATO insistiert.
Am 8. Januar 1990 klopft Botschafter Kwizinskij bei Teltschik [Ministerialdirektor im Bundeskanzleramt - Anm. Narrenschiffer] erstmals auf den Busch und bringt gewisse Versorgungsengpässe in der Sowjetunion zur Sprache. Fleisch, Fette, Pflanzenöl und Käse würden gebraucht.Die Lebensmittellieferungen der nächsten zwei Monate werden mit 220 Mio. DM gestützt und Kohl lässt Gorbatschow zu Beginn des Treffens im Februar zunächst mal recht herzlich danken.
Als sich Kohl am 10. Februar bei Gorbatschow einfindet, um über die Einheit zu verhandeln, läßt er es sich nicht nehmen, ganz zu Beginn der Unterredung auf die Lebensmittelaktion als Zeichen des deutschen goodwill hinzuweisen, worauf sich Gorbatschow erst einmal zu bedanken hat.Kohl legt nach und verknüpft Wirtschaftshilfe mit der NATO-Frage.
Kohl und Teltschik sind jedoch fest davon überzeugt, daß Gorbatschows wirtschaftlich bedrängte Lage bei seinem Nachgeben in der Frage einer NATO-Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands von größter Bedeutung ist.Gorbatschow wiederum verknüpft Wirtschaftshilfe mit Zusagen bezüglich des 2+4-Vertrags.
Offenbar setzt die Führungsrunde um Gorbatschow nunmehr auf das Konzept einer denkbar engen wirtschaftlichen Zusammenarbeit der Sowjetunion mit dem potenten Deutschland, um das ins Schleudern gekommene Experiment der »Perestroika« doch noch zu retten.
Der »Große Vertrag« und weitere Finanz- und Wirtschaftshilfen bilden eine wesentliche Komponente des Deals zur deutschen Einheit. Spöttisch, wie er sich manchmal auch gerne gibt, hat Kohl das schon Ende Februar beim Gespräch mit Bush in Camp David prognostiziert, als die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands zur Diskussion stand. »Was die Sowjets jetzt sagten«, meinte er damals wegwerfend, »gehöre zum Verhandlungspoker: Am Ende werde die Frage nach Bargeld stehen.«14 Und tatsächlich unternimmt Gorbatschow im allerletzten Moment, nur eine Woche vor Unterzeichnung des 2+4-Vertrags in Moskau, höchstpersönlich einen Vorstoß, um weitere Milliarden herauszuhandeln.15 Zwei Tage vor der Vertragsunterzeichnung am 12. September erhöht Kohl in einem langen Telefonat den zinslosen Kredit im Rahmen des Überleitungsvertrags auf insgesamt fünfzehn Milliarden DM.Valentin Falin, der sowjetische Botschafter in der Bundesrepublik von 1971 bis 1978, formuliert süffisant:
Für 4 ½ Milliarden konnte man alles bekommen. Ich habe gesehen, daß Gorbatschow alles in den Morast führt.Der Morast ist die 1990 beginnende Auflösung der Sowjetunion (Aufstände in den baltischen Republiken und in Azerbajdschan). Die "Satellitenstaaten" Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, DDR brechen weg. Kohl und Genscher erachten den Verbleib sowjetischer Truppen in der DDR für weitere vier Jahre als kalkulierbares Risiko. Auch um internationalen Gegenwind abzudämmen stimmt schließlich der Bundestag im Dezember 1990 für den Verzicht auf die ehemaligen "Ostprovinzen", sprich: für die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie.
Bereits 1991 überwirft sich Kohl durch die deutsche Nicht-Teilnahme am Golfkrieg mit den USA, auch wenn Militärbasen, Logistik und Geldmittel zur Verfügung gestellt werden. Seine Begründung ist beinahe prophetisch:
Ein Krieg gegen den Irak sei »nicht zu gewinnen. Bei einer militärischen Auseinandersetzung würden zwar die USA – vor allem durch Einsatz ihrer Luftwaffe – die ersten Runden gewinnen. Sollten sie es jedoch unternehmen, den Irak militärisch zu besetzen, würden sie Opfer eines gnadenlosen Kleinkriegs, dessen Ende nicht abzusehen sei. Gegen einen national und religiös gespeisten Widerstand sei nichts auszurichten.«Die 1990er Jahre sind geprägt durch die Kosten der Wiedervereinigung (wirtschaftlich, human, psychologisch), durch Arbeitslosigkeit und durch einen zerrütteten Staatshaushalt. Auch die Umfragewerte sind beinahe durchgehend kritisch. 1994 schafft Kohl nochmal eine Wiederwahl, 1998 unterliegt er hoffnungslos Gerhard Schröder von der SPD. Unvergesslich sein Streetfight am 10. Mai 1991 in Halle.

Bild: Peter Kneffel/dpa/lvz (LVZ-Artikel hinter Paywall, aber das Bild mit Quelle ist zugänglich)
International wird es mit dem Putschversuch gegen Gorbatschow nochmal heikel, auch bezüglich der sowjetischen Truppen auf deutschem Gebiet, doch nach Niederschlagung wird Kohl gut Freund mit Boris Jelzin, den er während seiner Amtszeit genauso unterstützt wie zuvor Gorbatschow, vor allem mit Hinblick auf eine stabile Lage in Deutschland.
Heikel ist auch der Jugoslawienkrieg, bei dem sich Kriegsallianzen bilden wie zuvor in den Weltkriegen. Frankreich eher pro-serbisch (zumindest bis zum Genozid von Srebrenica), Österreich, Italien und Ungarn wollen eine rasche Anerkennung von Slowenien und Kroatien. Kohl als Anti-Nationalist ist zögerlich, auch kann er mit dem nationalistischen kroatischen Premier Franjo Tudman nicht. Auch ist er sich dessen bewusst, dass jede Seite im Konflikt Kriegsverbrechen begeht. Die Wende war die Beschießung Dubrovniks im Juni 1991, am 23. Dezember 1991 anerkennt Deutschland Slowenien und Kroatien als unabhängige Staaten, im April 1992 wird Bosnien-Herzegowina anerkannt. Eine Beteiligung deutscher Soldaten im Jugoslawienkrieg lehnt Kohl ab:
»Kein Mensch geht in den Krieg. Dafür brauche man Hunderttausende von Soldaten.« Mit 500000 erfahrenen und gut ausgebildeten Soldaten, so erläutert er seine Position, konnte sich Deutschland 1941 bis 1945 in dieser Region militärisch nicht durchsetzen. Er halte es für ausgeschlossen, »jemals dorthin Soldaten zu schicken, die einen Krieg führen. Nach den ersten 1000 Toten würde die Stimmung in allen Ländern kippen.«Für die Nachkanzlerzeit sind die Spendenaffäre, der Freitod seiner Frau Hannelore und schließlich sein gesundheitlicher Zusammenbruch im Zentrum neben einer kritischen Würdigung seiner Leistungen.
Wie oben geschrieben, ist es ein faszinierendes Buch, da Schwarz nicht nur gut schreiben kann/konnte, sondern eine Unmenge an Dokumenten (Sitzungs- und Gesprächsprotokolle mit einbegriffen) verwendet hat und präsentiert. Aus einem raschen Durchblättern wurde nichts.
