Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Kim de L'Horizon - Blutbuch
13.08.2025 um 10:40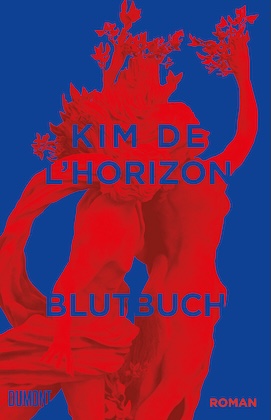
Kim de L'Horizon hat mit diesem Buch 2022 eine Autofiktion (die Erzählfigur ist mehr oder weniger L'Horizon selbst) vorgelegt, in der er die Demenz und den Tod seiner Großmutter mütterlicherseits zum Anlass nimmt, über seine Kindheit und auch die Herkunft zu ... reflektieren (?). Aber es ist auch ein Buch der Selbstreflexion. Über den eigenen Körper und dessen Grenzen zur Außenwelt, über den mit Blut gefüllten Körper, über Sexualität.
Handlung im eigentlichen Sinne gibt es nicht, der Text ist ein Assoziationsstrom. Er schreibe ohne Plan, vermerkt L'Horizon an einer Stelle, an einer anderen, dass er gerade im Vollrausch schreibe. Was dabei herauskommt, ist aber keine Nudelei im Sinne von nie enden wollenden Gitarrensoli der 1970er und 1980er Jahre, sondern ein Text, der alle Register der Sprachkunst zieht und in der fragmentarischen Strukturiertheit an Novalis erinnert. Jedem Aspekt ist sein eigener Stil zugeschrieben, und das in einer überzeugenden Art und Weise. L'Horizon ist ein Sprachriese. So gibt es ein Kapitel über das Kind Kim, das in Sätzen mit maximal sieben Wörtern geschrieben ist, weil es von der Eishexe verflucht worden sei und keine Sätze über sieben Wörter sprechen darf. Und dann gibt es das Märchen, das von einer altertümlichen Eleganz ist, die einen - mich zumindest - mit offenem Mund dastehen lässt:
Ein MärchenÜberzeugend ist auch das Kapitel, in dem die Ich-Figur aus einem Archiv der Mutter die Lebensgeschichten der weiblichen Vorfahren seit dem 14. Jahrhundert findet und Stellen daraus präsentiert. Es finden sich "Kräuterweiber", Prostituierte und schließlich Bäuerinnen.
Ich war einmal ein kleines Kind, dem sind der Peer und die Meer fortgestorben, und das war so bitterarm, das hatte kein Kämmerchen zum Wohnen und kein Bettchen zum Schlafen und gar nichts mehr ausser den Kleidern am Körper und ein Stück hartes Brot in der Hand, es war aber gut und fromm, und so ging es im Vertrauen auf den lieben Gott, der alles sieht, der wirklich alles, alles sieht, und da begegnete ihm ein armer Mann, und der sagte: »Ach, gib mir was zu essen, ich bin so hungerig«, und da reichte das Kind ihm das Stückelchen Brot und sagte: »Gott segne dir’s«, und es kam in einen dunkelen Wald, und es war schon düster geworden, da kam ein Kindelein und bat um ein Hemdelein, und das fromme Kind dachte: Es ist dunkle Nacht, da sieht dich niemand, du kannst wohl dein Hemd weggeben, und dann zog es das Hemd ab und gab es auch noch hin, und wie es so mutterseelenallein im Wald stand und nichts als Bäume da waren und es gar nichts mehr am Leib hatte, da kam ein bleicher Schemen, ein kleiner Geist, der sagte voll Bitterkeit, ein böser Ritter habe ihn erschlagen, nun habe er keinen Körper mehr und zu Hause aber warte sein kleines Brüderchen, das sonst niemanden habe, und das Gespenstchen bat sehr lieb um das Körperchen des kleinen Kindes, nicht um seinetwillen, sondern um des Brüderchens willen, und da gab das kleine Kind auch sein Körperchen hin, denn es hatte niemanden, nicht einmal ein Brüderchen, zum Umsorgen. Und wie es da unter den hohen Bäumen war und nichts mehr war und nichts mehr hatte ausser seiner Seele, da fing es an zu regnen, bis der ganze Himmel auf die Erde geregnet war. Und als die Erde ein einziges Meer geworden war, da löste sich das Kind auf und war ein Teil des Meeres. Und wenn es nicht gestorben ist, so ist es noch heute Teil davon, ein unsichtbarer Tropf im Meer.
Immer wieder sind Sprach- und Literaturreflexionen eingeflochten. So ist der Berner Dialekt zentrales Thema, und die französischen Wörter in diesem Dialekt seien ein Relikt des napoleonischen Kulturimperialismus, sie sollten nicht verwendet werden, wobei ironisch gespiegelt wird, dass die Erzählfigur selbst viele, sehr viele Wörter aus einer kulturimperialistischen Sprache nutzt, nämlich dem Englischen. Das letzte Kapitel (nie abgesendete Briefe an die Großmutter) ist komplett auf Englisch verfasst, da sich die Erzählfigur außer Stande sieht, dass Allerpersönlichste auf Deutsch niederzuschreiben. Fun fact: Eine deutsche Übersetzung dieses Kapitels ist angefügt, mit dem Hinweis: "Diese Briefe wurden übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)".
Viel Raum nimmt auch die eigene Sexualität ein. Die Erzählfigur sieht sich binär, ist aber schwul (weiblicher Part). Sie reflektiert über die Hardcore-Schwulenszene, in der sie sich mit ca. 20 herumtrieb - trainierte Muskeln, Waschbrettbauch, kein Fett - und distanziert sich in Rückblick von dieser Szene, die er "protofaschistoid" nennt:
wenn ich »protofaschistoide Sexualität« schreibe, so erinnere ich mich an die Römer (bzw. an den guten alten Lateinunterricht), die ja die Grundfesten der faschistischen Ästhetik gelegt haben.Aber es ist nicht nur die Ästhetik, sondern es sind auch Schwulenpartys mit rassistischen Zugangsbeschränkungen: "NO FATS NO FEMMES NO ASIANS". Der österreichische Standard hat dazu übrigens einen Artikel.
Es muss sich beim Lesen darauf eingestellt werden, dass L'Horizon auch die Pornosprache beherrscht. Sexualität und Sexszenen sind in einer Offenheit präsentiert, die durchaus irritierend sein kann.

