Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Gavriel Savit - Anna und der Schwalbenmann
26.08.2025 um 13:06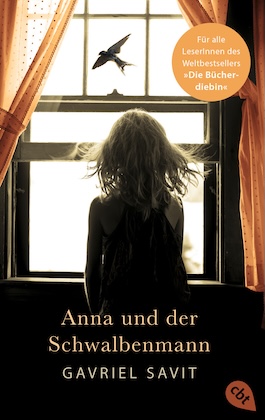
Der Eindruck lässt nicht los, dass der bei Erscheinen seines Erstlingromans 2016 28-jährige New Yorker Schauspieler und Musiker Gavriel Savit sich von Elem Klimovs Jahrhundert-Antikriegsfilm Komm und sieh (Wikipedia) hat inspirieren lassen.
Die Geschichte beginnt im Herbst 1939 in Krakau, der Vater der siebenjährigen Anna Łania ist Sprachwissenschafter an der Universität Krakau und wird am 6. November 1939 bei der "Sonderaktion Krakau" (Wikipedia) im Rahmen einer "Säuberung" polnischer Intellektueller verhaftet und ins KZ Sachsenhausen verfrachtet, wo er verstirbt. Zuvor bringt er Anna zu einem befreundeten Apotheker, der das Mädchen nach einer Nacht auf die Straße setzt. In die Wohnung kann sie nicht, da sie keinen Schlüssel hat, so bleibt sie vor der Apotheke sitzen, bis sie auf einen gut gekleideten, großen, schlanken Mann aufmerksam wird, der die Fähigkeit besitzt, Schwalben zu rufen und sie auf seinen Finger setzen zu lassen.
Anna zieht mit ihm aus der Stadt und damit beginnt eine eigenartige mehrjährige Odyssee durch Kriegspolen. Der Schwalbenmann zieht als Landstreicher umher, immer darauf bedacht, nicht als Fremder zu erscheinen. Essen und das Lebensnotwendige wird durch Geschenke, Diebstahl und nach Beginn des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion durch Leichenfledderei besorgt. Vom Holocaust ahnen sie etwas durch Erzählungen und Massengräbern, die sie auf ihren Wegen sehen, wie auch durch einen Flüchtling aus dem Ghetto Lublin, Reb Hirschl, einem fröhlichen Musiker und Trinker, der sich schließlich erhängt.
Der Schwalbenmann ist schweigsam, sie überqueren mehrfach Grenzposten an Zonengrenzen mit falschen Pässen und straßenweisen Tricks. Mit Reb Hirschl überqueren sie den Bug, um ins sowjetisch besetzte Polen zu gelangen, doch dies ist der 22. Juni 1941, sie geraten in die deutsche Offensive und beschließen, zurückzukehren, da sie nicht an der Front bleiben wollen.
Nach einer Episode in einem von deutschen Truppen verlassenen, bombardierten Landhaus, in dem der Schwalbenmann von Jugendlichen angeschossen wird, ziehen sie nach Danzig, wo sich das Geheimnis um den Schwalbenmann aufklärt, der nach der Ermordung eines aufdringlichen Krämers konstatiert: Dieser sei nur ein Leben, doch mit seinem Leben sei das Leben der Menschheit verbunden. Die Tabletten, die der Schwalbenmann regelmäßig einnehmen muss und die ihm ausgegangen sind, was eine psychotische Charakteränderung wie Haarausfall nach sich zieht, sind Kaliumiodidtabletten. Auch besucht er in Danzig einen alten Mann, mit dem er über "spaltbares Material" und Waffenfähigkeit spricht, auch wird er als Professor angesprochen. Ergo: Der Schwalbenmann ist Atomphysiker. Inwiefern diese Art von Untertauchen realistisch ist oder pure Fantasie, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall wird er mit regelmäßiger Einnahme der Tabletten psychisch wieder normal.
Welchen Beitrag der Schwalbenmann zur Entwicklung einer Atombombe hätte beitragen können, bleibt offen. Als relevanten polnischen Atomphysiker mit Bezug zur Atombombe finde ich Jozef Rotblat, aber der lebte ab 1938 in Großbritannien und ging 1943 nach Los Alamos. In Polen blieben seine Schüler Marian Danysz (er arbeitete aber in einem Telekommunikationsunternehmen) und Ludwik Wertenstein. Dieser hatte radioaktives Radium, tauchte bis zu seiner Flucht 1944 nach Ungarn unter, wo er während der Schlacht um Budapest ums Leben kam. (Info aus der polnischsprachigen Wikipedia) Wenn Savit eine reale Vorlage für den Schwalbenmann hatte, dann am ehesten Wertenstein.
Der Roman endet, dass der Schwalbenmann in Danzig Anna einem Fischer übergibt, der sie auf eine Fahrt mitnimmt. Der Schwalbenmann geht weg und verschwindet für immer aus Annas Leben. Sie selbst wird von dem Fischer in Richtung einer Insel gefahren. Ist die Halbinsel Hel gemeint? Gotland wird es kaum sein.
Als Lebensmotto des Schwalbenmann nimmt Anna dieses mit:
Menschen sind die größte Hoffnung des Menschen, zu überleben.Eine zentrale Rolle in diesem Text spielt Sprache. Anna wie der Schwalbenmann sprechen viele Sprachen, Anna wegen ihres Vaters und seiner Freunde, mit denen sie immer in unterschiedlichen Sprachen konversiert hat:
Mit ihren knapp sieben Jahren sprach Anna fließend Deutsch, Russisch, Französisch und Englisch, konnte sich auf Jiddisch und Ukrainisch verständigen und besaß Grundkenntnisse in Armenisch und dem karpatischen Romani. Ihr Vater sprach niemals Polnisch mit ihr. Polnisch, die Landessprache, erklärte er, käme von selbst.Wie realistisch dies ist, kann ich nicht beurteilen.
Aber: Sie können nicht nur viele Sprachen, sondern sie verwenden sie auch mit unterschiedlichen Akzenten, sodass das Gegenüber der Ansicht ist, Anna ist eine Deutsche oder der Schwalbenmann ein Russe aus irgendeinem sibirischen Gebiet. So bei der Zonenüberquerung in die sowjetische Zone:
Gewöhnlich reichte dem Schwalbenmann diese Aufforderung – ein Wort oder zwei –, um den Dialekt des Sprechers zu erkennen, doch er war so gewieft, dass er zunächst einen Moment vor sich hin murmelte, während er in seinem Arztkoffer herumkramte. »Ah«, sagte er dann in Sprache und Dialekt des Soldaten. »Natürlich. Papiere, Papiere, Papiere …«Ein zweites Kernthema ist Natur. Nicht nur dass der Schwalbenmann mit Vögeln kommunizieren kann, er gibt auch vor, auf seiner Wanderung ein Exemplar einer aussterbenden Vogelart zu suchen (welche, wird nicht genannt). An einer Stelle wird konstatiert, dass sie nicht nur von Betteln und Diebstahl lebten, sondern auch von den Früchten Polens. Der Schwalbenmann kennt die essbaren Beeren und Kräuter. An den masurischen Seen angeln sie. Hart wird es im Winter, als sie viele Hungertage durchmachen müssen.
Es kam auf das perfekte Timing bei der Übergabe des Dokuments an. Der Schwalbenmann musste die Frage stellen, bevor er dem Soldaten den Pass reichte, damit der Soldat antwortete, bevor er ihn öffnen konnte, doch er durfte dabei auf keinen Fall anbiedernd wirken.
»Woher kommen Sie?« Die Frage musste zurückhaltend klingen, fast unfreiwillig, als wäre es eine kleine Zumutung für ihn, überhaupt zu fragen.
Ganz gleich welcher Orts- oder Gebietsname dem Soldaten nun über die Lippen kam, stets riss der Schwalbenmann perplex die Augen auf und lachte durch und durch ehrlich überrascht. Eine Reaktion, wie sie nur von einem Landsmann stammen konnte: die verblüffte Freude, den Namen des geliebten Orts zu hören, wenn man so weit fort von daheim war.
Erst konnte Anna kaum glauben, wie täuschend echt der Betrug wirkte. Immerhin sah sie den Schwalbenmann, wenn nicht jedes Mal exakt gleich, so doch nicht weniger beglückt reagieren bei Namen, die so exotisch und fremd klangen wie Lindau, Saraisk, Machatschkala, Quedlinburg, Gräfenhainichen, Mglin und Suhl – Ortsnamen, die für Anna genauso gut Sterne an den entferntesten Ausläufern des Himmels bezeichnen konnten. Doch bald begriff sie, dass es gar keine Täuschung war.
Lügen stellen den Versuch dar, über die existierende Welt die hauchdünne Schicht einer Ersatzwelt zu stülpen, um sie den eigenen Absichten anzupassen. Der Schwalbenmann aber musste sich die Welt nicht anpassen. Er passte sich der Welt an. Das war es, was es hieß, die Sprache der Straße zu beherrschen.
Der Schlüssel ihres Erfolgs beim Grenzübergang war, dass der Schwalbenmann nie direkt sagte, er käme aus dem Ort, den der Soldat nannte. Die Menschen (auch verkleidete Raubtiere) waren sich ihrer Meinung sicherer, wenn sie sich einbildeten, sie hätten sie aus freien Stücken gefasst. Statt ihnen eine simple Lüge aufzutischen, erging sich der Schwalbenmann in einer Reihe von Fragen und Lobgesängen.
»Warum braut hier keiner Bier wie zu Hause?«, sagte er. »Was würde ich für ein gutes Helles geben.« Selbst wenn ausgerechnet dieser Soldat kein Biertrinker wäre (und welcher junge Mann war das nicht?), würde er niemals zurückweisen, dass ein Produkt seiner Heimat das Beste sei. Oder er sagte: »Wie ist das Leben auf dem Lenin-Prospekt?« Inzwischen gab es in jeder Stadt der Sowjetunion eine Straße, die nach Lenin benannt war. Oder er rief: »Unser Weihnachtsmarkt! Ich hatte solches Heimweh. Es ist doch die schönste Zeit im Jahr.« In welcher deutschen Stadt gab es keinen romantischen Weihnachtsmarkt? Und welcher junge Mann hatte kein Heimweh, wenn die Feiertage nahten und er durch irgendein gottverlassenes polnisches Feld stapfen musste?
Unklar ist, wie sie sich in Städten bewegen können. Der Schwalbenmann hat in seiner Tasche einen teuren Anzug. Nur: Eigentlich müssen sie verheerend gestunken haben. Das wird nie thematisiert.
Fazit: Kein uninteressantes Gedankenexperiment, ob man als Landstreicher in Polen von 1939 bis 1945 hat überleben können, aber nicht alle Aspekte scheinen mir realistisch dargelegt zu sein.
