Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Anna Mitgutsch - Die Züchtigung
22.08.2025 um 15:16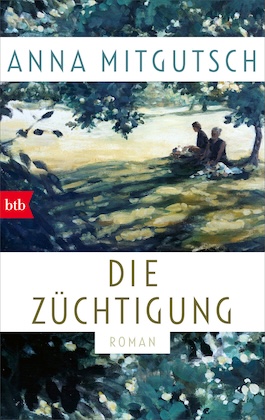
Die österreichische Autorin Anna Mitgutsch arbeitete als promovierte Literaturwissenschafterin (Germanistik, Anglistik) an Universitäten in Österreich, Großbritannien, Südkorea und den USA, bis sie nach dem Erfolg ihres ersten Romans Die Züchtigung (1985) mit 37 Jahren den Weg als freie Schriftstellerin einschlug.
In diesem Roman arbeitet sich Mitgutsch vermutlich an ihrer eigenen Biographie, an einer Hassliebe zu ihrer gewalttätigen und folternden Mutter ab, welche die feste Ansicht vertritt, dass Kinder nur mit brutalen Schlägen auf einen "rechten" Weg geführt werden können. Tatwerkzeug: Teppichklopfer. Das Leben ist von Armut geprägt, dennoch wird der Schein nach außen gewahrt, die Mutter ist äußerst gepflegt und trägt geschneiderte Kleidung aus bestem Stoff, auch wenn das Geld nur für ein Bad in der Woche reicht, und die ganze Familie badet im selben Wasser einer Badewanne.
Die Mutter Marie stammt aus einer Bauernfamilie im Norden Österreichs nahe der tschechoslowakischen Grenze und heiratet einen Ostfrontheimkehrer aus dem Zweiten Weltkrieg wegen seiner von Liebe triefenden Briefe. Als Personen werden sie sich nicht lieben. Aus der Sicht ihrer Eltern (auch der Vater ist ein brutaler Züchtiger) heiratet sie unter ihrem Stand, Friedl ist ein Häuslersohn (Besitzer eines kleinen Hauses, aber ohne Felder). Arbeit findet er in der Stadt (wird wohl Linz sein) als Straßenbahnschaffner, und er macht keine Karriere, bleibt zeitlebens Schaffner. Zunächst wohnen sie bei einem Bauern in einer schäbigen Wohnung an dessen Hof, dessen Frau demütigt das Ehepaar durch Boshaftigkeiten. Schließlich kaufen sie sich Blockhaus mit 25 Quadratmetern. Im ersten Stock befinden sich zwei Zimmer mit Dachschrägen, die über eine Hühnerleiter zu erklettern sind. Das Geld leiht ihnen ihr Vater und eine ihrer Schwestern. Zum Haus gehört ein Pachtgrund, auf dem sie Hühner halten und Gemüse anbauen können. In diese Verhältnisse kommt die Tochter Vera zur Welt.
Vera wächst in Armut auf, auch wenn der Hunger der Nachkriegsjahre vorbei ist. Seit sie denken kann, erinnert sie sich an die Züchtigungen ihrer Mutter. Keine Zornestaten im Affekt, sondern geplante Folter aus unterschiedlichesten Anlässen, die zu einem strafwürdigen Vergehen erklärt werden (Schmutz auf der Kleidung, aufgeschundenes Knie, Lachen in der Kirche). In der Schule fällt ihr Verhalten auf, sie wird untersucht, die blauen Flecken werden entdeckt, die Mutter wird ermahnt. Das war es. Das Schlagen geht ungehindert weiter. Vom antriebslosen Vater wird Vera auch nicht geschützt.
Nach der Kirche musste ich mich nackt ausziehen und wurde mit dem Teppichklopfer geschlagen, bis ich bewegungslos und lautlos auf dem Boden lag, und mein Vater sagte, da siehst du, was du mit deiner Brutalität ausrichtest, erschlagen tust du das Kind noch. Aber als ich geschrien hatte, Papa, Papa, hilf, war er auf dem Sofa gesessen und hatte nicht gewagt, in die Züchtigung einzugreifen.Veras Leistungen in der Schule sind unterschiedlich. In der Volksschule Klassenbeste, sie geht gegen den Willen der Eltern auf das Gymnasium, obwohl sie sich damit abfinden und sogar eine Privatschule sich leisten. Das ist die andere Seite der Eltern: Sie bringen finanzielle Opfer, um der Tochter (sie ist ein Einzelkind) eine Zukunftschance bieten zu können. Die Mutter hofft, dass Vera ihren eigenen Berufstraum wahr werden lässt: Klosterlehrerin. Erst am Ende der Gymnasialzeit fängt Vera sich wieder und legt die Reifeprüfung mit Vorzug ab. Das durch die häusliche Gewalt begründete psychische Auf und Ab zeigt sich auch körperlich. Bis zur Pubertät isst Vera Unmengen und wird immer dicker, ab der Pubertät verweigert sie Essen, bricht es und wird hager. Abgemagert.
Schlagen war ein Ritual, von Ritualen umgeben.
Über den weiteren Lebensweg Veras nach der Schule erfahren wir nur aus Eingesprengsel. Sie hat verschiedenste Beziehungen, vor allem mit Künstlern, von denen sie sich immer rasch trennt.
Später verliebte ich mich in Künstler, feminine Männer, Träumer, denen irgendwann die Träume zerfallen waren und die mich in ihre Träume hineinziehen wollten, sich von mir ihre Träume bestätigen und realisieren lassen wollten, während ich sie durchschaute, verachtete und enttäuscht weglegte.Vera ist alleinerziehende Mutter einer Tochter und will die Tradition gewalttätiger Erziehung defintiv nicht fortsetzen, was ihr postwendend wegen der Verhaltensauffälligkeit ihres Kindes Tadel eines Psychologen einbringt:
Das eine vor allem wollte ich von Anfang an, das Kind vor dieser Erbschaft der Selbstzerstörung bewahren. Den Zwang wollte ich fernhalten, die Angst vor der Strafe, die Demütigung, der Schwächere zu sein, und die Unfähigkeit, sich dagegen aufzulehnen. Sie ersticken das Kind mit Liebe, sagte der Psychologe, Sie können nicht loslassen, Sie hemmen seine Entwicklung. Das ist nicht wahr, wollte ich rufen, aber ich schwieg und nahm alle Schuld auf mich, ich hatte wieder einmal versagt.Die Mutter stirbt relativ jung. Sie hat über Jahre hinweg an Kopfschmerzen gelitten, und das eher scherzhaft gemeinte Bonmot ihres Mannes, dass da wohl ein Tumor in ihrem Hirn sitze, welcher der Grund für ihr Verhalten sei, stellt sich als korrekte Diagnose heraus. Nur ging Marie selten zum Arzt und dieser hat auch keine Ahnung, wie er diagnostizieren sollte. Es sei wohl psychisch. Als Marie verfällt, im Krankenhaus künstlich ernährt wird, Morphium gegen ihre Schmerzen erhält und schließlich stirbt, wird im Krankenhaus die wahre Diagnose gegeben: Ihr gesamter Körper war bereits von Metastasen zerfressen.
Vera reflektiert über die Zeit danach:
Ich trat ihr Erbe an, in den Trauerkleidern, die sie vom Spitalsbett aus für mich bestimmt hatte, mit der Frisur, die sie für richtig befunden hatte, kein Haar hing aus der Frisur. Ich wurde fromm, streng, unnahbar, misstrauisch und ehrgeizig. Ich glänzte in den Seminaren und biss vor Einsamkeit schreiend in die Polster. Mein Vater heiratete übers Jahr und wurde glücklich. Er konnte sich endlich erlauben, seinen Hass auszusprechen, seine zwanzigjährige Demütigung abzugrenzen, sie war ein Abschnitt seiner Vergangenheit geworden. Ich liebte sie und wollte werden wie sie, bis ich ihr Gegenteil wurde und sie hasste.Einblick bekommen wir auch in die Schwestern von Veras Mutter Marie. Rosi heiratet einen Lehrer, der Gedichte schreibt, sie jedoch permanent grün und blau schlägt und sich dabei befriedigt. Sie lässt sich scheiden. Ein Familienskandal. Die Scheidung, nicht die sadistische Perversion ihres Mannes. Angela wird Bäuerin und hat neben ihrer schweren Arbeit sechs Geburten in acht Jahren. Ihr Mann schlägt sie. Heidi heiratet ebenso wie Marie einen Häuslersohn (sogar einen unehelich geborenen). Dieser geht zur Zollwache an der tschechoslowakischen Grenze und sie können sich einen gewissen kleinbürgerlichen Wohlstand leisten. Auch ist er nicht gewalttätig, das Kind ist ein Wunschkind und sie können sich ein Motorrad leisten.
Auch Politik wird immer wieder angesprochen, vor allem die Zeit des Nationalsozialismus, über die die Kriegsgeneration der Mutter ein Schweigen gelegt hat.
Mitgutsch greift thematisch für die damalige Zeit Typisches in der österreichischen Literatur auf: Anti-Idylle des bäuerlichen und dörflichen Lebens, Armut, Familiengewalt und Nationalsozialismus. Sie war aber vermutlich die erste, die keine Vaterabrechnung, sondern eine Mutterabrechnung geschrieben hat.
