Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Jostein Gaarder - The Orange Girl
24.08.2025 um 13:03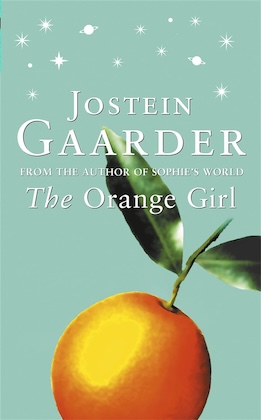
So richtig warm bin ich mit diesem Roman von Jostein Gaarder nicht geworden. Der Vater des 15-jährigen Georg Reed ist einer schweren Krankheit erlegen, als dieser vier Jahre alt war, und hat vor seinem Tod noch einen langen Brief an seinen Sohn geschrieben, den er in einem Kinderwagen versteckt hat und der nun zum Vorschein kommt. Georg liest ihn.
In diesem Brief erzählt er des Langen und Breiten, wie er als junger Medizinstudent mit einem Mädchen in der Straßenbahn zusammenstößt und dadurch veranlasst, dass sie einen großen Sack mit Orangen fallen lässt. Er verliebt sich in die junge Frau, die auch Augenkontakt mit ihm sucht. Wochenlang versucht er herauszubekommen, wer sie ist. Einmal kommt sie in sein Stammcafé und hält seine Hände, dann sieht er sie in einem Gemüsemarkt und in der Kathedrale bei der Weihnachtsmesse. Sie sprechen miteinander (sehr wenig), sie küssen sich, er ist erstaunt, als sie beim Weggehen ihn beim Namen nennt. Und: Er müsse sechs Monate warten, danach könne er sechs Monate täglich mit ihr zusammen sein.
Der Vater fühlt sich wie im Märchen mit seinen auferlegten Regeln, die nicht gebrochen werden dürfen. Auch geht seine Fantasie durch, wer es sein könnte und wozu sie so viele Orangen bräuchte. Schließlich kommt eine Karte von ihr vom Orangenhof der Kathedrale von Sevilla. Er solle noch ein paar Monate aushalten. Kann er aber nicht und fliegt nach Sevilla, wo er auf einem Platz im jüdischen Viertel hofft, dass sie vorbeikommt. Was sie auch tut und sie weist ihn nicht zurück. Nun löst sich die Story der ersten Hälfte auf. Sie heißt Veronika, die beiden waren als Kleinkinder Spielkameraden, nur er kann sich nicht mehr an sie erinnern. Nun studiert sie an der Kunstakademie in Sevilla, die Orangen benötigte sie als Übungsmodelle. Sie verlieben sich trotzdem, werden nach ihrer Rückkehr nach Oslo ein Paar, ziehen zusammen und übernehmen schließlich, nachdem seine Eltern an ihren Alterssitz gezogen sind, deren Haus und Georg kommt zur Welt. Rätsel gelöst: Das Orangenmädchen ist Georgs Mutter.
Der zweite Teil des väterlichen Briefs stellt die Sinnfrage des menschlichen Lebens, das in kosmische Zusammenhänge gesetzt wird: Größe und Alter des Universums gegenüber Kleinheit und Kürze des menschlichen Daseins, bis schließlich die zentrale Frage an Georg gestellt wird, da der Vater ein schlechtes Gewissen hat, ein Kind in die Welt gesetzt zu haben, wohlwissend, dass es mit dem Tod enden werde: Würde Georg, falls er zu Anbeginn des Universums die Frage gestellt bekommen hätte, ein kurzes Leben mit seinem tödlichen Ende wählen oder nicht.
Die Antworten und diesen Ich-Roman schreibt Georg auf dem alten Computer seines Vaters, dessen Passwort "Orangen" er erraten hat, in dessen Brief hinein. Er bejaht sie. Auch reflektiert Georg über diese Kontaktaufnahme durch seinen verstorbenen Vater. Er ist irritiert. Eigentlich sollten Tote sich nicht mehr bei den Lebenden einmischen.
Etwas heftig ist am Ende nach Lesen des langen Briefes auch sein Verhalten gegenüber seiner Mutter, die nun mit einem Jörgen verheiratet ist, der vor seinem Vater ihr Freund gewesen ist. Er schmeißt Kekse auf den Boden und nennt die Mutter "blöd".
‘... you’re bloody daft!’ I shouted. ‘You had two boyfriends at once!’Und gleich weiter ist sie für ihn ein "altes Huhn".
I almost felt a bit sorry for the old chick now. She was still pale. Despite myself I said: ‘Could I ask which of the two the Orange Girl was fondest of?’Dieses impertinente Verhalten passt eigentlich nicht zu dem eher gesetzten, nicht emotional hochbrausenden Stil des Textes.
‘No,’ she said emphatically, ‘you can’t ask.’
Mir ist die Stalker-Geschichte mit dem Orangenmädchen schlichtweg zu langatmig und die Fantasien des Vaters sind zum Teil an den Haaren herbeigezogen. Die Sinnfrage wird zu breit ausgewälzt. Und Georgs plötzliche Unverschämtheit gegenüber seiner Mutter ist unvorbereitet. Sie hat seinen Vater ja nicht sitzen lassen.
Fazit: Unausgegoren.
