Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Erich Hackl - Auroras Anlaß
22.11.2025 um 12:42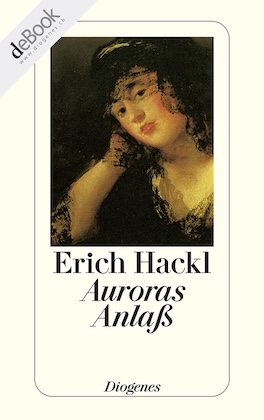
Erich Hackls Domäne ist die Dokufiktion. In dieser 1987 veröffentlichten Erzählung geht er ins frühe 20. Jahrhundert nach Spanien. Er zeichnet nach, warum 1933 Aurora Rodriguez ihre 18-jährige Tochter Hildegart im Schlaf erschossen hat. Runterbrechen lässt sich das Motiv darauf, dass eine Helikoptermutter, die sich in ihrer Tochter verwirklichen will, nicht akzeptieren kann, dass diese beschlossen hat, eigene Wege zu gehen.
Aurora wächst im verarmten Galizien auf, ihr Vater ist angesehener Rechtsanwalt und Freidenker. Schon früh kommt sie in Kontakt mit liberalem und sozialistischem Gedankengut, bildet sich in der Bibliothek ihres Vaters und hat zum Ziel, Gesellschaft und Frauen vom klerikal-konservativen Joch zu befreien. Ihr Vater stirbt, als sie 17 ist, und Aurora zieht, sobald sie volljährig ist, als Waise nach Madrid, wo sie vom Vermögen bzw. dem verkauften Gut ihres Vater selbst Grund erwerben und davon leben kann. Sie entscheidet, ein Kind ohne Vater aufzuziehen, und lässt sich von einem freisinnigen Priester, der sich als Scharlatan, Hochstapler und Betrüger herausstellt, schwängern. Es wird eine erwünschte Tochter.
Ihrer Tochter legt sie ein strenges Erziehungsregime auf. Sie muss bereits in Vorschulzeiten lesen lernen, kann mehrere Schulklassen überspringen und beginnt mit 13 Jahren ein Jurastudium, das sie innerhalb von vier Jahren abschließt. Gleichzeitig wird Hildegart in der sozialistischen Bewegung aktiv und setzt sich für die sexuelle Befreiung der Frau ein. Da dies kein politischer Hauptschwerpunkt ist, nähert sich Hildegart den Liberalen an. Auch verschärfen sich Konflikte mit ihrer Mutter.
Hildegart erwiderte barsch, daß Aurora ihr ganzes Leben über sie verfügt hatte, sie grundlos verfolgte und überwachte, so daß sie sich die Ahnungslosigkeit der Mutter nicht vorstellen könne. Sie habe sich entschlossen, nachdem Aurora Rodríguez, ohne sich um ihr Einverständnis zu bemühen, sogar einen Mann für sie ausgesucht hatte, ihren eigenen Willen durchzusetzen, frei und unabhängig zu leben, so wie sie es in ihren Schriften, die immer die Zustimmung der Mutter gefunden hätten, forderte.Als sie nach einer Begegnung mit H. G. Wells von ihm und dem Sexualwissenschafter Havelock Ellis nach London eingeladen wird, um an der Universität eine Stellung einzunehmen, wird Hildegart vor Abreise von ihrer Mutter erschossen. Vor Gericht gibt sie an, Hildegart hätte sie angefleht, sie vor ihren Verfehlungen zu retten, sei aber zu schwach für den Freitod gewesen. Aurora wird in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen, während des Franco-Regimes verliert sich ihre Spur. Es gibt Gerüchte, sie habe noch bis in die 1970er Jahre gelebt.
Die Erzählung ist streng komponiert, die Erzählperspektive durchgehend neutral beschreibend. Es gibt weder Erzählerkommentare, Wertungen noch Innensichten. Mehrfach erinnert dieser Stil an Kleist'sche Erzählungen.
Herausragend ist Auroras Aussage vor Gericht, als sie die Verfehlungen ihrer Tochter mit der Bibelerzählung von Kain und Abel gleichsetzt. Eine Täter-Opfer-Umkehr, die einen sprachlos zurücklässt.
Kain und Abel.
Man hat uns beigebracht, Kain zu hassen. Ihn als ersten Verbrecher der Menschheitsgeschichte hingestellt, als ersten Brudermörder. In den Räubergeschichten der sogenannten Heiligen Schrift hat man ihn so dargestellt, wie es später auch Wells tat: mit Affengesicht, mit Affenhänden, krummen Beinen und fliehender Stirn, abschreckend also für den Geschmack heutiger Leser.
Und doch ist Kain unter allen Helden der christlichen Mythologie der größte. Damit der Leser die wahren Ursachen von Abels Tod begreift, gebe ich zwei Zitate wieder, die von Marc Conelly und George Bernard Shaw stammen, zwei hellen Köpfen unserer Zeit: »…Abel lachte mich aus, weil ich immer arbeitete, während er im Schatten eines Baumes rastete. Er nannte mich einen Dummkopf, weil ich nicht untätig blieb.« »Abel wollte sich mit dem Alten begnügen, das Land bebauen, nur eine Frau besitzen, nicht jagen, nicht kämpfen. Er lachte über mich, weil ich kämpfte, jagte, liebte und anders arbeiten wollte.«
Wer also ist Abel? Wenn wir uns an die Zitate halten, dann erkennen wir in ihm einen Vorläufer der sozialistischen Politiker, die über die Arbeiter lachen, müßig sind, alles ablehnen, was ihrer Bequemlichkeit abhold ist. Einen Propagandisten der Trägheit, der nichts wissen will, nicht kämpfen will und edler Konkurrenz aus dem Weg geht.
Kain dagegen ist das Symbol des Fortschritts. Er ist der erste Anarchist. Und als solcher ist er aufsässig. Er gehört nicht zu den Zufriedenen und Satten. Er ist ein Genie. Abel wäre nie aus der Masse der Anonymen aufgetaucht, hätte ihn uns nicht die Bibel als Opfer hingestellt, als wäre die Tatsache, daß er eines war, nicht schon Beweis seiner Unterlegenheit. Im übrigen umgibt ihn die Aura einer frommen, dümmlichen Klosterschülerin. Er ist ein Feind des Fortschritts, verschlossen dem ungestümen Gang der Zivilisation, unfähig zum Kampf und zur Liebe. Ein kleiner Geist; Kain dagegen ist groß.
Nötig ist es also, Kain zu folgen, der auf seinem Weg alle Hindernisse beseitigt, selbst seinen Bruder, eine reinigende Tat. Kain ist bereits Mensch. Abel noch eine Puppe in Gottes Händen. Was Schöneres finden wir in der Bibel als Kain, der den göttlichen Willen mißachtet und ein Leben vernichtet, das keines ist, weil es ihm an Willenskraft mangelt!
Kain ist Inbegriff des Widerstandes gegen alles Althergebrachte. Abel der des Mittelmaßes. Kain ist der Hirte, Abel ein Schaf der Herde. Wie glücklich wäre eine Gesellschaft, in der es nur Menschen wie Kain gäbe! Obwohl es wahrscheinlich unmöglich ist. Um sie zu erkennen, braucht es die anderen, die Schar der Abel, der Dummen, die über uns lachen.
Als Opfer gilt immer der Tote, nie aber der, dessen Tat, so bedauerlich sie auch sein mag, Größe anhaftet. Wer sich, wie Abel, mit den alten Mächten arrangiert, wer nachgibt, auf halbem Weg stehenbleibt, hat sein Leben verwirkt. Kain hatte die Verpflichtung, Abel zu töten. Er konnte nicht anders. Das Opfer hat den Täter veranlaßt.
