Narrenschiffer
Diskussionsleiter

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

dabei seit 2013Unterstützer
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen
Frank Witzel - Inniger Schiffbruch
09.06.2021 um 22:38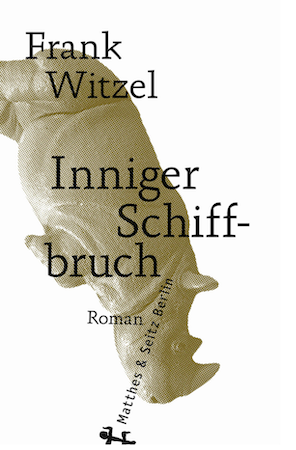
Ein in der Kritik gelobtes, aber für mich schwer zugängliches Buch. Witzel schreibt in über 400 Seiten über den Tod seiner Eltern und wie er deren Leben sowie sein eigenes anhand von schriftlichen wie bildlichen (Fotos, Super-8-Filme) Überresten rekonstruiert, die er beim Sichten der Bestände im leerstehenden Elternhaus findet. Struktur gibt es keine, es ist ein Assoziationsflickwerk, das immer wieder von Lesefrüchten autobiographischer Texte (Thomas Bernhard zum Beispiel) sowie Träumen (es erscheint ein Nashorn im Elternhaus und einmal Adorno) durchsetzt ist. So gibt es Historisches (die Nazizeit spielt immer wieder eine Rolle bei Großeltern und auch Eltern, die Mutter eine Vertriebene aus Gleiwitz) und Nabelschauen, als ob Witzel seine eigene Kindheit nochmal leben möchte. Dazu kommen Vergleiche seines eigenen Lebens als Reflektierender, der als Mitt-Sechziger vergleicht, wie seine Eltern in dem selben Alter gelebt haben.
Mit Knausgards Sezierungen hat dieser Text überhaupt nichts zu tun, er bleibt sehr oberflächlich. Die ständige Wiederkehr zu Fotos und Super-8-Filmen zeigt letztlich nur eine Oberfläche. Dass ein Panoptikum Westdeutschlands der 60er Jahre gezeigt wird, wie in manchen Kritiken hervorgehoben wird, erschließt sich mir nicht. Denn dann bestände dieses Land nur aus Leuten, die vor dem Fernseher hocken, wenn sie nicht gerade arbeiten. Und das ist nicht unbedingt eine bildungsferne Familie gewesen, der Vater Leiter eines Orchesters in Wiesbaden. Die Mutter Hausfrau (dann doch typisch).
Nur einmal wird mit einer Figur aus der langweiligen "Erinnerungsarbeit" (so nennt Witzel seine Arbeit am Text) ausgebrochen. Ein gewisser Sattler sitzt laut Aufzeichnungen seines Vaters paranoid in einem Irrenhaus und fantasiert über Verfolgungen durch Geheimdienste. Leider ist die Passage nur kurz, aber über Sattler hätte ich gerne mehr gelesen, da nicht nur die Figur interessant ist, sondern mit ihr Witzel auch richtig gut zu schreiben beginnt.
Manchmal bricht durch, dass Witzel sein eigenes Leben auch nicht sehr aufregend findet. So zum Beispiel mit der Feststellung, dass er eigentlich außer seinen Lebensrecherchen nur mit dem Fahrrad zum Rewe fahre, um Tütensuppen zu kaufen. Typisch wird viele Seiten später diese Art von langweiligem Leben auf Grundlage von Texten des ungarischen Autors Imre Kertész (mit einem Aufenthalt im KZ Auschwitz war dessen Leben wohl eher nicht "langweilig") interpretiert: Es werde ein von außen determiniertes Leben geführt, das aufgrund von fehlenden Entscheidungsmöglichkeiten kein Schicksal mehr haben könne. Keine Ahnung, warum Witzel sich mit einem Auschwitzhäftling vergleicht.
Ohne selbst den Tod der eigenen Eltern bereits erfahren zu haben, hätte ich diesen Text (Roman ist es eigentlich keiner) kaum zu Ende gelesen. Trotz der sprachlichen Meisterschaft, die Witzel durchaus besitzt, ist das alles zu dahinplätschernd und manchmal zu zynisch. Zum Beispiel wenn er die Fantasien seines demenzkranken Vaters, der abends im Rollstuhl vom Wohnraum ins Schlafzimmer geschoben wird und meint, mit einem Auto in die Wohnung einer Geliebten gefahren zu werden, die spiegelverkehrt zu seiner sei, mit dem literarischen Doppelgängermotiv vergleicht, würde ich mir einen strengen Lektor wünschen, der Witzel begleitet hätte. Vielleicht wäre nicht eine solche orientierungslose Psychotherapiesitzung als Text erschienen. Und ja, er beginnt mit einem Gespräch Witzels mit seiner Therapeutin. Ob es die gibt, weiß ich nicht. Ist aber egal. Denn die Therapeutin sind wir Leser, die uns diesen Monolog geben, während Witzel auf der Couch ihn spricht/schreibt.
