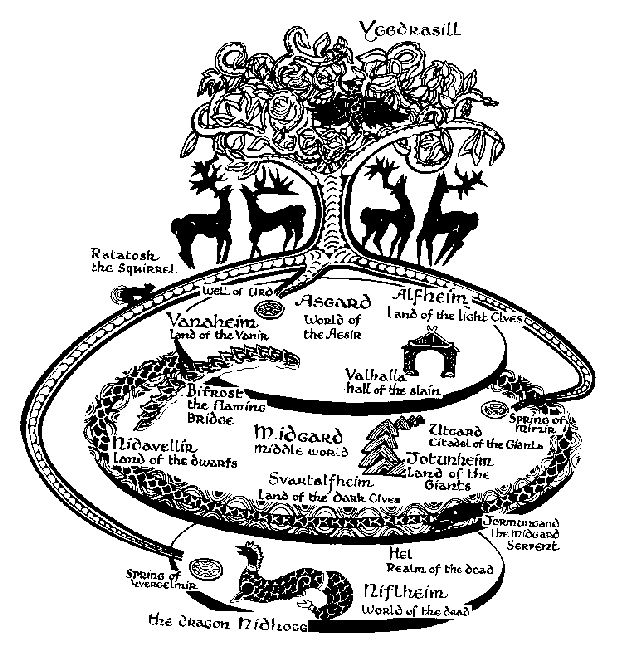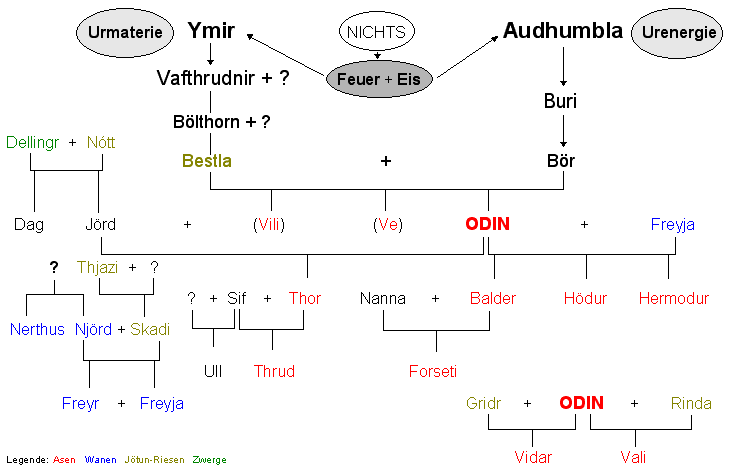Nordische Mythen
17.12.2004 um 23:07
@ Hi all
Sagen um Wolfdietrich
Die Sage von Wolfdietrich und seinem Geschlecht ist fränkischer Herkunft. Der Vater des Wolfdietrich heißt in der Sage Hugdietrich. Hugo Theodoricus, d.i. Hugdietrich, ist aber als Name von Chlodwigs Sohn überliefert. Es ist der gleiche Dietrich, den wir als Überwinder Irminfrieds aus der germanischen Heldendichtung kennen. Wir hörten damals auch, welcher Vorwurf ihn zum Haß und Kampf gegen Irminfried antrieb: der Vorwurf unehelicher Geburt. Seine Brüder, erzählen uns die Geschichtsschreiber, mißgönnten ihm, dem Bastard, die Ansprüche auf sein Reich, und er hatte manchen Kampf zu bestehen, bis er sich durchsetzte. Diese Streitigkeiten der Geschichte klingen in den Kämpfen nach, die der Wolfdietrich der Sage führt. Die Sage verschmolz aber, wie so oft, die Schicksale des Vaters, des Hugo Theodoricus, und die seines Sohnes, des Theodebert. Dieser mußte in der Wirklichkeit Ähnliches erleben wie der Vater, und darum begreift es sich leicht, daß sie in der Erinnerung späterer Geschlechter zusammenfielen. Nicht nur dem Bruder, auch dem Sohne des Bruders machten nämlich Chlodwigs echte Söhne das Reich streitig. Theodebert aber behauptete sich durch die Treue und Standhaftigkeit seiner Dienstmannen.
Der Hergang des alten Liedes über die Kämpfe des Wolfdietrich war demnach wohl der: Die Brüder überfallen und vertreiben den Bastard, dem sie das Reich nicht gönnen, im Elend halten ihm seine Recken die Treue, er gewinnt sich Anhänger, bekämpft mit ihnen wieder die Brüder und besiegt sie. Ein Lied dieser Art entspräche ungefähr den uns bekannten Liedern von den Schildungen und von dem Kampf um Finnsburg.
Dem treuen Ratgeber stellte das Lied den bösen gegenüber. Dieser entwickelte sich wieder aus der Geschichte und zwar aus der fränkischen Geschichte. Die allmächtige Stellung des fränkischen major domus, des königlichen Hausmeisters, gab ihm seine Besonderheit und seine Gewalt, die er dann in unserer Sage mißbraucht, um den Bastard zu verdrängen und um seine Mutter zu verleumden. Dieser böse Ratgeber hieß Sabene; schon der Widsith kennt und nennt ihn, bei ihm heißt er Seofola.
Es hatte nun die Sage vom Wolfdietrich eine große Ähnlichkeit mit der des gotischen Theoderich. Wie dieser wurde der fränkische Theoderich von seinem Erbe vertrieben, lebte nur von wenigen Getreuen begleitet in der Verbannung und eroberte sich schließlich sein Reich zurück. Sogar die Namen beider Herrscher waren die gleichen. Es ist darum kein Wunder, wenn eine Sage die andere beeinflußte, und wenn aus der Sage Dietrichs von Bern der treue Berchter von Meran in die Sage von Wolfdietrich herüberwanderte.
In den deutschen Geschichten des dreizehnten Jahrhunderts von Wolfdietrich hat Berchter sechzehn Söhne; sechs fallen im Kampf mit den Brüdern Wolfdietrichs, und Berchter sieht jedesmal, wenn
einer den Todesstreich empfängt, lachend zu seinem Herrn herüber und sucht ihn zu trösten. Als dann Wolfdietrich seinem wilden Schmerz um den Verlust der Jugendgespielen sich hingibt, fährt ihn der Alte rauh an, ihm und seinem Weib sollte er die Tränen überlassen, er müsse jetzt an die Flucht denken. Mit den lebenden Söhnen deckt Berchter dem Herrn den Rückzug und ermöglicht ihm die Flucht. Dann harren sie alle auf Wolfdietrichs Wiederkehr. Sie werden von den Brüdern Wolfdietrichs gefangen genommen und müssen in Jammer und Not ihr Leben hinbringen, je zwei zusammengeschmiedet, werden sie auf die Burgmauer als Wache gesetzt. Berchter stirbt vor Herzeleid, als Wolfdietrich nicht zurückkehrt. Als der König endlich, als Pilger verkleidet, zu den Söhnen kommt, sagen sie ihm, den Tod des Vaters wollten sie wohl verschmerzen; den Tod ihres Herrn würden sie niemals verwinden. Mit den Worten: "Lebtest du, Wolfdietrich, du ließest uns nicht in solcher Armut", sei Berchter dahingegangen. Um ihres Herrn willen bieten sie dem Pilger ihren Panzer an, als er sie um Gottes Willen um ein Stück Brot bittet. Das sei ihre einzige Habe, und von dem Erlös könne er sich Brot und Wein kaufen. Wolfdietrich gibt sich nun zu erkennen. Berchters Söhne flehen Gott an, er möge ihre Bande lösen, wenn der Pilger wahr gesprochen. Da springen ihre Fesseln, sie eilen von der Mauer, öffnen das Tor, erobern die Stadt und besiegen Wolfdietrichs Brüder. Mitternachts bemerkt Wolfdietrich einen Sarg neben dem Sarg seines Vaters; es ist der Berchters. Der König reißt die Steine vom Sarg und umarmt und küßt den Toten, dessen Leichnam noch unzerstört ist. Die Söhne entschädigt er durch reichen Lohn für alle Leiden, die sie um seinetwillen erduldet.
Die Treue des Gefolgsmannes gegen den Herrn ist die gemanische Grundlage dieser Erzählung. Aber wie weichlich und sentimental, wie unnatürlich und romanhaft überspannt, wie unwahr erscheint uns diese versechzehnfachte Treue und dieser Jammer, wenn man sie etwa mit der vergleicht, die der Hildebrand des alten Liedes für seinen Dietrich hatte, und mit dem Weheruf, der seinem gequälten Vaterherzen entringt, als er den Sohn verlieren soll. Den stumpfen Hörern, auf die der Dichter des Wolfdietrich wirken wollte, mußte er wohl solche Übertreibungen vorsetzen, damit sie die Treue des Lehensmannes überhaupt fühlen und annehmen und darüber die gebührenden Tränen vergießen sollten. Spielleute und Christentum haben hier zu gleichen Teilen die alte Heldendichtung verweichlicht und ihre hohe und große Hingebung, ihre Überwindung des Todes herabgezogen. Nichts war dem Wesen des germanischen Helden entgegengesetzter als unerwartete und wunderbare Erlösungen, als weinerliche Rührung und als Lächeln in Tränen. Und gerade damit hat der Spielmann die Geschichte von Berchter und seinen Söhnen angefüllt.
Wenn nun die Dichtungen von Wolfdietrich vom dreizehnten bis zum sechzehnten Jahrhundert immer von neuem gelesen und umgedichtet wurden und sich einer besonderen Beliebtheit erfreuten, so kann, wie uns die Geschichte von Berchter zeigt, der Grund dieser Beliebtheit nicht der Geist und die Kunst der alten großen Lieder gewesen sein. Die Heldensage, aus der der Wolfdietrich hervorging, war in den späteren deutschen Gedichten auch nur der Rahmen, und nicht nur den Berchter und das Ende der alten Dichtung haben die Spielleute des dreizehnten Jahrhunderts auf ihre Art umgebildet. Die Gestalt des bösen Ratgebers hat sich zum Beispiel in ihren Händen auch verwandelt, in den bösen Ratgeber, den wir aus Märchen und Legende kennen. Nachdem er die Königin verleumdet hat und in die Verbannung geschickt ist, weiß er nach dem Tode des Hugdietrich die Huld seiner Witwe wiederzugewinnen, verdrängt den treuen Berchter und reizt die beiden älteren Brüder gegen den Jungen auf, ja er bringt sie dazu, daß sie die Mutter, seine Wohltäterin, vertreiben.
Der eigentliche Inhalt und das Anziehende für die wundersüchtigen und unterhaltungslüsternen Zeitgenossen waren in den Dichtungen des späten Mittelalters die Abenteuer, die Wolfdietrich während seiner Verbannung erlebte, die sich fortwährend vermehrten, veränderten und durcheinanderschoben und derentwegen auch sein Vater und seine Geburt mit sonderbaren Erfindungen umgeben wurden.
Wie Wolfdietrich selbst, ist sein Vater Hugdietrich aus einer Vermischung von Vater und Sohn hervorgegangen. Den Namen hat er von Chlodwigs Sohn, die Werbungsgeschichte, die auf ihn die Dichtung des dreizehnten Jahrhunderts überträgt, hat sich aus der alten Sage von Chlodwigs Werbung gestaltet.
Das Heroische dieser alten Sage: Crothilds Rache hat unser Dichter abgestreift. Manches in ihr klang aber auch nach Novelle und Abenteuer: Von Crothilds Schönheit waren die Boten Chlodwigs erfüllt. Ihr Onkel hielt das Mädchen in strengem Gewahrsam und versagte sie dem Werber. Der Bote des Königs mußte sich verkleiden, die Christin wollte dem Heiden nicht folgen. Diese Bestandteile hat der Dichter des dreizehnten Jahrhunderts verstärkt: Walgunt von Salneck (Salonichi) hat eine Tochter Hildburg, deren wunderbare Schönheit der treue Berchter dem Herrn rühmt. Doch der Vater hält sie in einen Turm eingesperrt und will sie keinem Mann geben. Hugdietrichs gelbes Haar reicht ihm bis zu den Hüften, wir erkennen darin den stolzen Schmuck der fränkischen Könige. Dem Spielmann aber war das lange Haar das Zeichen des Weibes, so gab er dem Jüngling ein rosenfarbenes Antlitz zu den goldenen Locken und berichtete, er habe sich als Mädchen verkleidet und sich mit großem Gefolge nach Salneck begeben. Der Griechenkönig, sein Bruder, sagte er dort, habe ihn vertrieben. Hildburg fand solches Gefallen an der lieblichen Jungfrau, daß sie bat, man möge sie ihr zur Gespielin geben. Wirklich wurde sie mit ihr in den Turm eingeschlossen und beschämte die Königstochter und ihre Gespielinnen durch ihre Kunstfertigkeit in weiblichen Handarbeiten. Nach länger als einem halben Jahr erschien der alte Berchter, wie es vorher verabredet war, und brachte die Meldung, nun sei der Zorn des Bruders verraucht. Hugdietrich kehrte also zurück. Nach kurzer Zeit genas Hildburg eines Sohnes, und als Hugdietrich das hörte, kam er noch einmal, aber als Mann, zur Geliebten, küßte sein Kind, versprach ihm Konstantinopel als Erbe, nahm Hildburg zur Frau und führte sie heim.
Die Erfindung, daß sich der Werber als vertrieben ausgibt, brachte uns schon der Rother, und die Geschichte von Hetel und Hilde wird sie uns noch einmal bringen. Sie gehörte, wenn man so sagen darf, zum Inventar der Werbungsgeschichten, die uns die Spielleute erzählen, auch die Idee, daß der Mann, als Frau verkleidet, zur Geliebten dringt, ist uns nicht fremd, die Sage von Hagbard und Signe kannte sie. Dort aber, im dänischen Heldenlied, erschraken die Dienerinnen der Königstochter über die männliche Rauheit des Wesens, das sich als Mädchen ausgab, und sie nannte sich stolz und trotzig eine Walküre. In der deutschen Spielmannsdichtung ist Hugdietrich weiblicher noch als ein Weib, und die Geschichte seiner Werbung wird nicht ohne versteckte Lüsternheit vorgetragen. Mit der alten Heldenart hat sie wieder nichts gemein, und es ist sehr möglich, daß unser Spielmann die ganze Erfindung nicht aus der germanischen Überlieferung, sondern aus einer der spätgriechischen Geschichten holte, die das Mittelalter seiner Zeit kannte und liebte.
Von Wolfdietrichs Geburt erzählt die Geschichte von Hugdietrich noch weiter, daß Hildburg das Kind vor ihren Eltern verbarg. Einmal trat ihre Mutter unerwartet in den Turm, da ließ sie das Kind in das Gebüsch am Fuß des Turmes herab. Dort fand es ein Wolf und trug es als Speise zu seinen Jungen in die Höhle, doch die waren noch blind und taten dem Kleinen kein Leid. Am nächsten Tag, während Hildburg verzweifelt und umsonst nach ihrem Knäblein suchte, fand es ihr Vater bei den Wölfen, entzückte sich über seine Schönheit, trug es zu seiner Frau und ließ es taufen. Nun begibt sich eine Familienszene. Als die Mutter ihrer Tochter das Wunder erzählte, da offenbarte sich ihr Hildburg und erhielt ihre Verzeihung. Die Mutter aber brachte des Nachts im ehelichen Bette das Geheimnis ihrem Manne bei. Der war zuerst sehr ungebärdig und stellte dann nach Art der Männer durch eine genaue Untersuchung den Hergang der Dinge noch einmal fest. Als ihm dabei klar wurde, daß er eine gewisse Schuld daran habe, ließ er den Vater seines Enkelchens holen, der denn auch gern den Sohn anerkannte.
Viel hübscher und kindlicher erzählt eine andere Fassung des Wölfdietrich die Geburt unseres Helden. Wir geben sie mit Ludwig Uhlands Worten wieder:
Zu Konstantinopel herrschte ein gewaltiger König namens Hugdietrich; zwei Söhne hat ihm seine Gemahlin geboren, beide hießen Dietrich. Einst mußte er zum Kriege ausziehen. Reich und Gemahlin empfahl er dem Schütze des Herzogs Sabene. Dieser aber suchte die Königin zu unerlaubter Liebe zu verleiten; als sie ihn zürnend abwies, verredete er seine schmähliche Zumutung, es sei nur eine List gewesen, um ihre Treue zu erproben. Die Königin glaubte ihm und versprach, darüber zu schweigen. Noch in Abwesenheit des Königs genas sie eines dritten Sohnes, den sie bei seiner Abreise im Schöße getragen. Der König freut sich bei seiner Heimkehr des neugeborenen Kindes. Sabene aber verleumdet die Königin, sie habe dem König die Treue gebrochen, und der junge Sohn sei eines teuflischen Unholds Kind.
Der König hat einen treuen Mann, Herzog Berchter von Meran; diesem befiehlt er, das Kind zu töten. Lange weigert sich der Treue, erst die schrecklichsten Drohungen bringen ihn zum Nachgeben. Er empfängt das Kind und reitet mit ihm in den Wald; aber wie das unschuldige Kind mit seinen Panzerringen lachend spielt, bringt er den Mord nicht übers Herz, und doch schämt er sich wieder, um eines Kindes willen so zage zu sein, da er doch in heißer Schlacht schon gar manchen Mann gefällt. So kommt er, schwankenden Sinnes weiterreitend, zu einem Gewässer, in dem Seerosen blühen. Hier legt er das Kind an den Rand und überläßt es seinem Geschick; er meint, es werde nach Kinderart nach den Wasserrosen haschen, und so werde sich des Königs Wille erfüllen, ohne daß ihn Blutschuld belaste. Aber das Kind spielt auf der Wiese bis in die Nacht hinein. Da kommen Wölfe aus dem Wald und schnobern es an; das Kind greift nach ihren Augen, die in der Dunkelheit wie Lichter glänzen, aber keines der Tiere tut ihm etwas zuleide. Darüber staunt Berchter und beschließt, den Knaben zu retten; einem Wildhüter gibt er es zur Erziehung und nennt es Wolfdietrich.
Die Königin, der das Kind, während sie schlief, weggenommen worden war, bricht beim Erwachen in lautes Wehklagen über den Raub aus, der König schiebt, nach des bösen Sabene Rat, alle Schuld auf Berchter. Berchter wird gefangen genommen und vor Gericht gestellt; niemand wagt für ihn einzutreten, da der König auf den Rat des tückischen Sabene allen seinen Mannen es verboten. Schon soll das Urteil gesprochen werden, da tritt Berchters Schwager, Baltram, in den Ring und verlangt ein Gottesurteil; wer Berchter des Mordes bezichtige, der solle mit dem Angeklagten kämpfen. Sabene weigert sich, und als ein Schriftstück eröffnet wird, worin Berchter den ihm gewordenen Auftrag und die Schicksale Wolfdietrichs berichtet, ist seine Schuld offenbar. Sabene soll gehängt werden, aber eingedenk der früheren Freundschaft schenkt ihm auf seine flehentlichen Bitten Berchter das Leben. Doch muß er als Verbannter das Land verlassen. Wolfdietrich aber wird aus dem Walde geholt und von Berchter in Gemeinschaft mit den eigenen Söhnen erzogen.
In dieser Erzählung lebt die Unschuld und Einfalt unserer Legenden und Märchen, und wir entzücken uns daran wie an den Geschichten, nach deren Vorbild sie wohl geschaffen wurde, wie an der von der armen Genovefa und dem bösen Golo oder an dem Märchen von der verleumdeten unschuldigen Königin oder an dem von dem armen Kind, das eine grausame Stiefmutter töten lassen wollte, und das zu töten der Diener doch nicht über das Herz brachte.
Dem ganzen Bericht von Wolfdietrichs Geburt hat das Märchen und die Legende einer alten Sage eine Lieblichkeit und Anmut geschenkt, die vorher ihrem Wesen fremd war und an der wir uns dankbar erquicken, wenn sie auch nicht heroisch ist.
Die alte Sage, der die beiden Berichte von Wolfdietrichs Geburt entsprangen, ist, wie wir vermuteten, eine Sage, wie sie gerade die alten Franken liebten: Daß ein Held darum so kräftig und unbändig war, weil er von Wölfen abstammt. Von Krafttaten und Unbändigkeiten des Knaben Wolfdietrich wissen auch die Spielleute manches zu melden, sie gleichen denen des starken Hans im Märchen und denen des jungen Siegfried in späterer Überlieferung.
Von den Heldentaten des vertriebenen Wolfdietrich wurde sehr gefeiert die, daß er einen Drachen und seine Brut besiegte, der einem mächtigen König Ortnit das Leben genommen. Es war ein schwerer Kampf, das eigene Schwert sprang dem Helden in Stücke, und er siegte erst, als er in der Höhle, in die ihn der Drache geschleppt, Ortnits Schwert fand. Nach Art des Märchens erwies er sich als der Sieger, indem er als Wahrzeichen einem lügnerischen Nebenbuhler, der die Köpfe brachte, die Zungen des Untiers entgegenhielt. Der Königin gab er sich dann durch einen Ring zu erkennen. Dann wurde Wolfdietrich der trotzigen Vasallen der Königin Herr, und sie reichte ihm ihre Hand und die Krone. Nun erst konnte er ausziehen, um Berchter und seine Söhne zu befreien.
Den Inhalt des Gedichtes von Ortnit erzählt uns Ludwig Uhland so:
Ortnit, der junge König in Lamparten (Lombardei) auf der Burg zu Garden (Garda), findet keine kronwürdige Braut, weil alle Könige diesseits des Meeres ihm dienen. Darum will er nach der Tochter des Heidenkönigs Machorel zu Muntabur fahren, obgleich schon viele Häupter der Werber um sie auf den Zinnen der Burg stecken. Zuvor reitet er in die Wildnis am Gartensee (Gardasee), von dem wunderkräftigen Stein eines Ringes geleitet, den ihm die Mutter gegeben. Vor einer Felswand, aus der ein Quell fließt, sieht er auf blumigem Anger eine Linde stehen, die fünfhundert Rittern Schatten gäbe. Unter der Linde liegt ein schönes Kind im Grase, köstlich gekleidet, mit Gold und Gesteinen reich geschmückt. Es ist der Zwergkönig Alberich, dem Berge und Tale dienen. Lange neckt und prüft der starke Zwerg den Jüngling: Zuletzt entdeckt er sich als dessen Vater. Dann geht er in den Berg und holt für Ortnit eine leuchtende Rüstung samt dem herrlichen Schwert Rose. Zum Abschied verspricht er, dem Sohne stets gewärtig zu sein, solange dieser den Ring habe.
Die Zeit der Meerfahrt ist herangekommen. Zu Messina eingeschifft, fahren sie erst nach Suders, der Heiden Hauptstadt, wo vor allem Iljas, König aller Reußen, Ortnits Oheim, als Heidenvertilger wütet. Von da ziehen sie vor die Königsburg Muntabur, auf des Gebirges Höhe. Alberich hat seines Wortes nicht vergessen; er saß die ganze Fahrt über auf dem Mastbaume, keinem sichtbar, als wer den Ring am Finger hatte. Überall schafft er Rat und Hilfe. Jetzt weist er die Straße nach Muntabur, dem Heere mit dem Banner vorreitend; aber nur Roß und Fahne sind sichtbar, der Träger nicht. Er neckt den Heidenkönig, wenn dieser nachts, sich zu kühlen, an die Zinne tritt, rauft ihm den Bart, wirft das Wurfgeschütz und die Särge der Heidengötter in den Graben. Er zeigt der Königstochter von der Zinne den Helden Ortnit, wie er herrlich im Streite geht, sein Harnisch leuchtend, blutig das Schwert. Da spricht sie: "Er ist eines hohen Weibes wert." Alberich führt sie heimlich zur Burg hinaus, wo Ortnit sie vor sich zu Rosse gebt und mit ihr davonrennt. Mit den verfolgenden Heiden besteht der Held siegreichen Kampf; des Heidenkönigs schont er um der Tochter willen. Auf dem Meere wird sie getauft und erhält den Namen Liebgart (Sidrat nach anderen Fassungen), nach der Heimkunst aber wird ihre Krönung zu Garten gefeiert.
Der alte Heidenkönig, Versöhnung heuchelnd, sendet reiche Geschenke. Zugleich aber bringt sein Jäger zwei junge Lindwürmer mit, die er im Gebirg oberhalb Trient in einer Felsenhöhle großzieht. Nach Jahresfrist kommen sie heraus und schweifen gierig umher. Ihr Pfleger selbst ist ihnen kaum entronnen. Niemand wagt mehr die Straße zu ziehen; die Äcker werden nicht eingesät, die Wiesen nicht gemäht. Bis vor die Burg von Garten wird das Land verwüstet. Tod droht dem Helden, der sie zu bestehen wagt.
Da beschießt Ortnit, der Not des Landes zu steuern. Umsonst fleht ihn die Unheil ahnende besorgte Gattin, von dem Unternehmen abzustehen; er reißt sich aus ihren Armen und heißt sie, wenn er fallen solle, dereinst seinem Rächer ihre Hand zu reichen. Ohne Gefolge reitet er in den wilden Wald, um den Lindwurm aufzusuchen und zu bestehen. Fahrtmüde rastet er unter einem Baume und versinkt in tiefen Schlaf. Da wälzt sich der Lindwurm heran; vergeblich sucht der treue Hund durch Bellen und Scharren seinen Herrn zu wecken, zu tief ist sein Schlaf. So findet Ortnit von dem Lindwurm, der ihn verschlingt, den Tod.
Die Spielleute haben in diesem Gedicht die Neckereien des Alberich gewiß mit besonderer Freude und mit drastischen Gebärden vorgetragen. Als alten Bekannten begrüßen wir sonst darin die Werbungssage. Mit ihr ist aber eine andere Geschichte verschmolzen. Der überirdische Helfer, der unsichtbar machende Stein, die Rüstung und das Schwert gehören nämlich in das Märchen von dem Helden, der in die Hölle fährt, oder der eine Jungfrau aus der Gewalt eines Unholdes oder Behausung eines Riesen befreit und dabei die Hilfe eines gütigen Wesens von überirdischer Kraft genießt. Auf diesem Märchen beruht wohl das französische Heldengedicht von Hüon von Bordeaux. Darin hilft Oberon dem Hüon, wie Alberich dem Ortnit, eine schöne Sultanstochter zu entführen. Den Hüon wiederum wird unser deutscher Spielmann gekannt und verwertet haben. Auch der Wolfdietrich der Spielleute glich, gerade in seinem Zusammenhang mit Ortnit, einer altfranzösischen Heldendichtung, dem Karlmeinet. Dieser berichtet, wie ein Thronerbe von seinen neidischen Verwandten vertrieben wird, sich in der Ferne die Gunst eines anderen Königs erwirbt und mit dessen Hilfe sein mächtiges Reich zurückerobert. Die Lieblingsgeschichte der französischen Epen, daß der alternde Held ins Kloster geht, wird ja auf den deutschen Wolfdietrich übertragen und dort hat er außerdem mit den Seelen derer zu kämpfen, die er im Leben erschlug.
Germanisch an dem Gedicht von Ortnit ist der Name Alberich. Auch das mag, wie wir schon andeuteten, eine germanische Vorstellung sein, daß Alberich sich als den Vater des Helden enthüllt. Ursprünglich war er wohl die Seele des verstorbenen Vaters oder eines anderen Vorfahren und lieh ihm, unsichtbar wie die Seelen der Verstorbenen wirken, seine mächtige Hilfe. Die Schönheit des Alberich und sein Aussehen, daß er einem Kinde gleicht, wird in der deutschen Sage gerade den Seelengeistern, z.B. den mit den Eiben verwandten Kobolden, beigelegt.
Sehr verwunderlich scheint uns der Schluß des Gedichtes: Daß der heidnische König dem Ortnit gleich zwei Lindwürmer ins Land schickt, daß der Held vor dem Kampf einschläft, daß ihm Alberich nicht hilft und daß der treue Hund sich vergeblich müht, ihn zu wecken. Germanisch klingt diese Erfindung nicht - welcher germanische Held wäre wohl vor einem Kampfe eingeschlafen? -, doch gleicht sie persischen Erzählungen. Da der Ortnit in seinen Namen (Machorel und Muntabur) und auch sonst sehr deutliche Erinnerungen an Kreuzzüge (die von 1212, 1217 und 1218) zeigt, ist es wahrscheinlich, daß mit diesen Erinnerungen auch der Schluß des Gedichtes aus dem Orient in das deutsche Gedicht wanderte.
Wolfdietrich selbst zeigt ebenfalls manche Einflüsse von der Fabulierfreude des Orients, von Geschichten, die als Erinnerungen von den Kreuzzügen nach dem Abendlande zogen. Die Kämpfe zwischen Löwen, Drachen und Elefanten oder die zwischen den Löwen und einem Serpant, die sich darin begeben, sind wohl orientalischer Herkunft, und ebenso scheint das Messerwerfen eine orientalische Kunst, Wolfdietrich übertrifft darin einen Heiden, der sich auf seine Götter verläßt. Die Tochter des Heiden liebt unseren Helden. Doch weil sie nicht getauft ist, widersteht er ihr, trotzdem ihre Reize und ihre Zärtlichkeiten ihn verwirren. Wolfdietrich zeigt hier die gleiche übernatürliche Keuschheit, durch die manche Heilige der Legende sich hervortun. Der Erzähler übertreibt sie absichtlich und sogar in das Komische hinein, denn seine Hörer hätten sonst kaum aufgemerkt, sie verlangen grobe Reize. Deshalb malte der Spielmann auch die Schönheit und die Verführungsversuche der Heidin recht derb und lüstern aus. Zornig, daß er sie verschmähte, bringt die Schöne am nächsten Morgen den Helden in Not, indem sie, als er fortreiten will, vor ihn einen See und einen Wald zaubert, doch dieser und anderer Spuk verschwindet, als Wolfdietrich Gott anruft.
Die anderen Abenteuer der Gedichte führen uns zu den Zwergen, Riesen, wilden Leuten, Wassergeistern und ihresgleichen. In einer Fassung gelangt Wolfdietrich nach mühseliger Wanderung an das Meer, schön und anschaulich schildert der Dichter den Weg, den der Held zwischen Geröll und umgestürzten Bäumen hinabgeht, und die See, deren Wogen sich tosend an hohen Felswänden brechen. Als er, zu Tode erschöpft, eingeschlafen, entstiegt ein Meerweib den Fluten, weckt den Helden, wirft ihre Hülle ab und steht in leuchtender Schönheit als Herrin aller Wassergeister vor ihm. Wolfdietrich weist ihre Werbung zurück, trotzdem erquickt sie ihn und sein Pferd mit einer Zauberwurzel und weist ihm den Weg.
In einer anderen Fassung sind die Erlebnisse des Wolfdietrich noch bunter und vielfältiger. Als er nachts im Walde Wache hält, naht sich ihm, liebebegehrend, auf allen Vieren kriechend, ungeschlacht wie ein Bär, ein Waldweib, die rauhe Elfe; er weist sie entsetzt zurück, da schlägt sie ihn mit Sinnenverwirrung, so daß er noch in der Nacht zwölf Meilen hin und her läuft und schließlich unter einem Baum das liebegierige Ungestüm wiederfindet. Als er sich ihr voller Widerwillen nochmals versagt, wirft sie einen noch stärkeren Zauber auf ihn, er sinkt betäubt nieder, und sie schneidet ihm zwei Haarlocken vom Kopf und die Nägelspitzen von den Fingern. Nun ist ihm alle Kraft genommen, und der Arme läuft, verzaubert wie ein Tor, im Wald umher und nährt sich von den Krautern der Erde; endlich erbarmt sich Gott seiner und befiehlt durch einen Engel dem Weib, den Zauber aufzuheben. Nun will Wolfdietrich sich mit der rauhen Elfe vermählen, wenn sie sich taufen lasse. Da führt sie ihn zu Schiff in das Land Troja, wo sie Königin ist, läßt sich dort in einem Jungbrunnen taufen, steigt daraus als Schönste der Frauen hervor, heißt Sigeminne, und Wolfdietrich vermählt sich nur zu gern mit ihr.
Später - das ist wieder eines der Anhängsel und eine Stoffvermehrung, wie die Spielleute sie lieben - verliert Wolfdietrich die Frau, als er zur Jagd ausreitet. Als Pilger verkleidet eilt er ihr nach, und nach langer Wanderung findet er sie endlich wieder. Ein wilder Mann hatte sie verschleppt, er wollte die Widerstrebende zum Weib. Wolfdietrich besiegte ihn und die Scharen der ihm gehorchenden Zwerge. Dann entraffte ihm doch der Tod die kaum wiedergewonnene Frau. Der Held war nun wieder frei und konnte den Kampf mit dem Drachen bestehen, dem Ortnit erlag.
Das Abenteuer mit der Meerfrau und das mit der rauhen Elfe sind im Geschmack der höfischen Epen, die von Artus und seinen Rittern erzählen, von Iwein und von Erec, von Wigalois,. von Lanzelot und den anderen. Diese Helden treffen auf ihren Fahrten wunderbare überirdische Frauen, sie werden verzaubert und mit Sinnenverwirrung geschlagen, oder sie erlösen durch ihren Mut ein Wesen, das zuerst als häßliches Ungetüm sie erschreckt und sich dann, als der Ritter seine Tapferkeit behält und das Erlösungswerk auf sich nimmt, in die schönste Frau verwandelt. Unser Erzähler fügt in seinem Bericht den Herrn und einen Engel hinzu und macht ihn dadurch gottgefälliger. Durch die wilden Leute und Zwerge erhöht er andererseits seine Volkstümlichkeit. Uns wäre die Geschichte der rauhen Elfe in der einfachen Gestalt lieber, die sie vielleicht in einer früheren Form unsres Gedichtes besaß; daß die Frau den Wolfdietrich verzaubert, sich seiner erbarmt, nachdem sie ihn genug gestraft und ihm dann, als Ersatz für seine Leiden, ihre ganze liebliche Schönheit enthüllt und schenkt.
Die wirre Abenteuermasse der Wolfdietrichdichtungen ist noch reicher. Wir wollen sie hier nicht ganz ausbreiten und wollen noch weniger, da auch die Forschung noch nicht zur Klarheit gelangte, uns in Vermutungen ergehen, von wem die einzelnen Geschichten stammen und in welcher Folge und in welcher Art sie sich an und in die Gedichte von Wolfdietrich setzten. Daß verschiedene Dichter sich an diesen Epen versuchten, ging auch aus unseren Angaben hervor, wir fanden neben der Einfalt und Anmut der Legende freche Spielmannserfindungen, neben frischer, lebendiger und humorvoller Erzählung endlose Breiten und Stoffanhäufung.
Nacheinander sind bei dieser Betrachtung des einen Epos von Wolfdietrich alle Gattungen an uns vorübergezogen, die für die deutsche erzählende Dichtung im Mittelalter Bedeutung gewannen: Legenden und Märchen, Novellen und Fabeleien aus dem Orient, französische Heldendichtung und das höfische Epos. Unserem Gedicht haben diese Zusätze einen ganz ungewöhnlichen Stoffreichtum gegeben, aber sie machten es auch immer zusammenhangloser und wirrer. Statt der Heldendichtung steht in Wolfdietrich schließlich ein nicht enden wollender abenteuerreicher und formloser Roman vor uns, recht von der Art, wie sie das Volk immer will; seine Grundlage, das Heldenlied, ist von dem Erzähler unter der Fülle der späteren Erfindungen ganz verdeckt worden. Gegen den Reichtum der Ereignisse im Wolfdietrich war die späte Form der Wielandsage fast arm. Wir genießen es aber bei dem deutschen mittelalterlichen Gedicht dankbar, daß, wenn auch dunkle oder aufgebauschte, so doch Erinnerungen an die Treue und die Wildheit der alten Heldensagen in diesem Gewirre der Abenteuer erklingen, und daß unter den vielen Geschichten so liebliche und anmutige, so zarte und so kindliche auftauchen.
Dietrich von Bern
Die Entwicklung der Sage von Theoderich ist uns bekannt. Im Gegensatz zur Geschichte galt er als verbannter König. Odoaker hatte ihn vertrieben, und nachdem er lange die Gastfreundschaft Attilas genossen, eroberte er sich endlich die Heimat zurück. So erzählte uns im achten Jahrhundert das Hildebrandslied. Außer dem Theoderich galten nun noch einem anderen gotischen König oft erzählte Sagen, dem Ermanarich. Dieser Ermanarich drängte sich dann in die Sage von Dietrich von Bern ein, davon wissen zuerst Zeugnisse des elften und zwölften Jahrhunderts. Er wurde darin der Oheim des Dietrich, und auf Anstiften des Odoaker, der auch sein Neffe war, vertrieb Ermanarich den Dietrich. Dann verschwand Odoaker, dem keine besondere Sage galt, ganz aus der Überlieferung. An seine Stelle trat der böse Ratgeber Sibiche, dessen Aufstachelung bewog den Ermanarich zur Grausamkeit und Heimtücke gegen den Neffen, bis dieser vor seiner Übermacht fliehen mußte und bei Etzel Schutz und Hilfe fand. Die deutschen Gedichte des dreizehnten Jahrhunderts ziehen die Geschichte von Dietrichs Verbannung in die Länge. Dem Dietrich gelingt die Eroberung Italiens erst beim zweiten Versuch, beim ersten wird er zurückgetrieben. Bevor er in sein Elend ziehen mußte, lassen sie den Dietrich den Ermanarich einmal besiegen, und dazu erfanden die Dichter noch allerhand andere Kämpfe und Siege; in ihren Epen verwandelt sich die Sage in ein wirres, zielloses und endloses Hin und Her.
Den Inhalt der beiden großen Gedichte, die uns von der Verbannung und Heimkehr Dietrichs derart breit und weitschweifig erzählen - es sind das Gedicht von Dietrichs Flucht (besser das Buch von Bern) und das von der Rabenschlacht -, faßt Ludwig Uhland so zusammen.
Sibiche reizt den Ermenrich, seinen Neffen, den Dietrich von Bern zu verraten und sein Erbe an sich zu ziehen. Randolf von Ancona wird, unter Verheißung reichen Lohnes, als Bote nach Bern abgefertigt; der König wolle über Meer fahren, der Harlungen Tod zu büßen. Dietrich möge kommen und so lange des Reiches Pfleger sein. Als Randolf die Straße reitet, trocknen ihm die Augen nicht, wenn er des Mordes denkt, den er werben soll. Zu Bern richtet er die Botschaft aus, wie er geheißen ist, warnt aber den jungen Fürsten, er solle die Reise lassen und seine Festen besetzen. Dann reitet er zurück und meldet, daß Dietrich nicht komme. Fürder will Randolf nicht mehr zu dem Könige stehen, sondern alles für Dietrich wagen. Ermenrich rüstet nun große Heerfahrt und wütet mit Mord und Brand, bis Dietrich in nächtlichem Überfall das feindliche Heer vertilgt. Ehrlos entflieht Ermenrich und läßt seinen Sohn mit achtzehnhundert Helden in Dietrichs Hände fallen.
Dietrich hätte nun gerne den Recken gelohnt, die ihm Land und Ehre gerettet. Aber leer sind die Kammern, die sein Vater Dietmar voll Schatzes hatte. Hildebrand trat ihm sein und der Seinigen Gut an, und Bertram von Pola bietet so viel, als fünfhundert Säumer tragen können. Sieben Recken werden mit Bertram nach dem Golde gen Pola gesendet: Hildebrand, Sigeband, Wolfhart, Helmschart, Amelolt, Eindolt und Dietleib von Steier. Da legt Ermenrich an die Straße fünfhundert Mann unter Witege; sie überfallen Dietrichs Recken auf der Heimkehr und führen sie samt dem Schatze gefangen nach Mantua. Dietleib allein entrinnt und sagt die Märe zu Bern. Dietrich, nur um seine Recken, nicht um das Gold klagend, erbietet sich, für die Lösung der Sieben den Sohn Ermenrichs und die Achtzehnhundert, die mit ihm gefangen wurden, freizulassen. Ermenrich aber droht, die Recken Dietrichs aufzuhängen, wenn dieser nicht all seine Städte und Lande für sie hingebe. Man rät dem Berner, um die Sieben nicht alles zu verlieren, aber er ließe lieber alle Reiche der Welt als eine getreuen Mannen; so willigt er in Ermenrichs Begehren.
Ermenrich zieht nun mit Heereskraft vor Bern. Dietrich aber reitet aus der Stadt zu des Königs Zelt, steigt ab und beugt mit nassen Augen das Haupt ihm zu Füßen. "Gedenke", spricht er, "daß ich bin deines Bruders Kind, daß meine Einsicht noch schwach ist! Nimmer will ich deine Huld verwirken; laß ab von deinem Zorne!" Lange schweigt Ermenrich, dann heißt er drohend den Jüngling aus seinen Augen gehen. Um die eine Stadt Bern fleht Dietrich, nur bis er zum Manne gewachsen. Umsonst; Ermenrich droht nur grimmiger. Da bittet Dietrich nur noch um seine sieben Mannen und will mit ihnen von hinnen reiten. Auch diese Ehre wird ihm nicht gelassen, zu Fuß soll er seines Weges ziehen. Mehr denn tausend Frauen kommen aus dem Tore, für ihren Herrn bitten. Zuvorderst geht Frau Ute mit vierzig Jungfrauen; sie fallen vor Ermenrich nieder und mahnen ihn bei aller Frauen Ehre, an seinem Neffen königlich zu handeln. Er stößt sie von sich und gestattet auch ihnen nicht, in der Stadt zu bleiben. Da scheiden Männer und Frauen zu Fuß von Hab und Gut, Hildebrand hat Frau Ute an der Hand, der anderen Recken jeder die seinige. Jammervoll ob all der Schmach geht Dietrich von seinem Erbe, nimmer soll man ihn lachen sehen bis zum Tage, da er sein Leid rächen könne. Die Frauen werden nach Garda geführt, das der treue Amelolt besetzt hält. Ein Stein hätte weinen mögen, wie jetzt Frau und Mann, Mutter und Kind sich zum Abschied küssen. Fünfzig Getreue gehen mit Dietrich ins Elend, durch Isterreich in das Land der Hunnen. Dietrich wird von Etzel gütig aufgenommen und weilt an seinem Hofe. Er wird dort hochgehalten, aber er kann den Schmerz um sein verlorenes Erbe und seine gefallenen Helden nicht verwinden. Die milde Königin Helche bemerkt seine beständige Trauer; ihn zu trösten, vermählt sie ihm die schöne Herrad, ihre Nichte, und Etzel verspricht, zum Frühjahr ein Heer auszurüsten, mit dem Dietrich Italien wieder erobern soll. Das Frühjahr kommt, zu Etzelnburg sammelt sich ein Heer, zahlreich wie keines zuvor. König Etzel hat zwei herrliche junge Söhne, Scharpf und Ort. Diese wünschen sehnlichst, mit Dietrich zu reiten und seine gute Stadt Bern zu sehen. Sie wenden sich erst an die Mutter. Frau Helche sieht ihre Kinder traurig an, ihr hat geträumt, ein Drache sei durch ihrer Kammer Dach geflogen, habe vor ihren Augen die beiden Söhne hinweggeführt und sie auf weiter Heide zerrissen. Als aber die Jünglinge nicht ablassen, legt die Mutter selbst Fürbitte bei Etzel ein. Ungerne gewährt er. Dietrich verheißt, sie treulich zu behüten und nicht über Bern hinaus reiten zu lassen. Mit viel Tränen werden sie entlassen. Das Heer zieht durch Isterreich gegen Bern (Berona). Hier sollen Etzels Söhne zugleich zurückbleiben. Dietrich befiehlt sie auf Leben und Ehre dem alten Helden Elsan. Niemals sollen sie auch nur vor das Tor kommen; er droht, den Pfleger mit eigener Hand zu töten, wenn ihnen irgend Leides geschehe. Er bricht nun mit dem Heere gen Raben auf, wo Ermenrichs Kriegsmacht liegt. Den Jünglingen aber ist herzlich leid, daß man sie nicht mitgenommen. Sie knien vor ihrem Meister Elsan nieder und küssen ihm die Hände, daß er sie nur vor die Stadt reiten lasse, all den herrlichen Bau zu sehen. Er widersteht ihren Bitten nicht, und ehe er noch sich gerichtet, sie zu begleiten, sind sie schon zur Stadt hinaus. Es naht schon dem Herbste, wo die Nebel stark sind; so kommen die drei Jünglinge auf einen unrechten Weg, der sie über die weite Heide gegen Raben (Ravenna) führt. Elfan reitet ihnen nach und findet sie nirgends um die Stadt; laut ruft und jammert er, niemand antwortet ihm. Vor dichtem Nebel kann er sie auch auf der Heide nicht erschauen. Den ganzen Tag streichen sie hin und übernachten im Freien. Am Morgen reiten sie weiter, nach dem Meere zu. Diether fängt an, diese Irrfahrten zu bereuen. Als aber der Nebel weicht und die Sonne heiter scheint, da bewundern Etzels Söhne die Herrlichkeit des Landes, darin der Berner immer mit Freuden wohnen sollte.
Da erblicken sie den Recken Witege, der mannlich unter seinem Schilde hält. Sie wollen diesen Verräter an Diether und seinem Bruder sogleich angreifen, obschon sie, statt Harnischen, nur Sommerkleider anhaben. Umsonst warnt Witege mehrmals. Scharpf reitet zuerst ihn an und schlägt ihm starke Wunden: Da zuckt Witege mit Grimm das Schwert Mimung, mit gespaltenem Haupte schießt der Jüngling vom Rosse. Wäre er zum Mann erwachsen, ihm hätten alle Reiche dienen müssen. Ort will den Bruder rächen und erleidet gleichen Tod, obschon Diether ihm beigestanden. Dieser kämpft noch bis zum Abend zu Fuße; seine Gewandtheit, darin ihm niemand gleich ist, fristet ihn so lange; zuletzt fällt auch er, durch das Achselbein bis auf den Gürtel gehauen. Ihn betrauert Witege, Dietrichs Zorn fürchtend; er will zu Rosse steigen, aber die Kraft versagt ihm, und er muß sich auf der Heide niederlegen.
All das geschah um die Zeit der zwölftägigen Schlacht, worin Ermenrich bei Raben von dem Berner besiegt wurde. Er entflieht zur Stadt; den Verräter Sibiche fängt der treue Eckhart und führt ihn, quer auf das Roß gebunden, durch das Heer. Dietrich freut sich auf der Walstatt des Sieges, da kommt Elfan und meldet, daß er die jungen Könige verloren. Mit eigenen Händen, wie gedroht war, schlägt Dietrich ihm das Haupt ab. Die drei Erschlagenen werden auf der Heide gefunden. Dietrich küßt ihre Wunden, verflucht den Tag seiner Geburt und weint vor Jammer Blut. "Armes Herz", spricht er, "daß du so fest bist!" An der Größe der Wunden erkennt er, daß sie mit dem Schwert Mimung geschlagen sind.
Da sieht man Witege rasch über die Heide reiten. Grimmig springt der Berner auf und reitet so hastig nach, daß keiner der Seinigen ihm folgen kann; Feuer sprüht von den Hufschlägen. Speer, Helm und Schild hat er auf der Walstatt zurückgelassen, nur das Schwert führt er mit sich. Er ruft Witege an, mahnt, fleht ihn bei Heldenruhm und Frauenehre, zum Kampfe zu halten, verheißt Bern und Mailand, verheißt sein ganzes Reich, wenn Witege obliege. Aber Witege jagt nur stärker voran. Rienold, sein Neffe, der mit ihm reitet, schämt sich der Flucht und will auch ihn zum Kampfe bewegen: Zu zweien würden sie den Berner bezwingen. Witege will nicht hören, befiehlt den Neffen in Gottes Schutz und jagt weiter. Rienold sticht seinen Speer auf den Berner, dieser haut ihn vom Rosse, reitet Witege nach und reizt ihn, Rienolds Tod zu rächen. Je länger, je mehr eilt Witege, mahnt unablässig seinen Schemming, verspricht ihm Gras und lindes Heu in Fülle. Schemming macht weite Sprünge. Dietrich klagt, daß Schemming, einst ihm gehörig, seinen Feind von hinnen trage; er treibt sein jetziges Roß Falke, daß es von Blute trieft; vor Zorn glüht er, daß sein Harnisch weich wird. Kaum eines Roßlaufs Weite ist noch zwischen den beiden, Witege ist bis an das Meer getrieben, er gibt sich verloren. Da kommt die Meerfrau Waghild, seine Ahnmutter, und nimmt ihn samt dem Roß auf den Grund des Meeres. Der Berner reitet bis zum Sattelbogen in das Meer nach; er muß umkehren und wartet vergeblich, ob Witege wieder erscheine.
Noch erstürmt Dietrich die Stadt Raben, daraus Ermenrich, die Seinen verlassend, um Mitternacht entweicht, während die Stadt in Flammen aufgeht. Doch der Sieg führt zu keiner dauernden Behauptung Italiens, Dietrich muß zu den Hunnen zurückkehren und sendet Rüdiger voraus, daß er ihn bei Etzel und Helche entschuldige; er selbst wagt noch nicht, ihnen vor die Augen zu treten. Als der Markgraf mit seinen Helden zu Gran ankommt, laufen die herrenlosen Rosse der zwei jungen Könige mit blutigen Sätteln auf den Hof. Die Königin will eben mit ihren Frauen in einen Garten gehen, an den Blumen ihr Auge zu weiden, da sieht sie die blutigen Rosse ihrer Kinder stehen. Im ersten Schmerz verwünscht sie den Berner: Doch sie wird versöhnt, als Rüdiger meldet, daß Dietrich mit ihnen den eigenen Bruder verloren. Sie ist selbst Dietrichs Fürsprecherin bei Etzel. Der Berner kommt nach Etzelnburg, geht in den Saal, neigt sein Haupt auf Etzels Fuß und bietet sein Leben zur Sühne. Die Königin weint, und Etzel richtet mit neuer Huld ihn auf.
Der schmerzliche und tränenreiche Ton in dieser Geschichte, der breite und weitschweifige Vortrag und die mühselige und unbeholfene Diktion sind nicht in der Art und dem Geschmack der alten Heldendichtung. Freilich ermüden und verdrießen sie in den Gedichten selbst den Leser viel mehr als in Uhlands gedrängter Wiedergabe. Ebensowenig war das Auftreten Dietrichs in den alten Gedichten des siebenten Jahrhunderts so sanft und so demütig. Trotzdem wittern wir in diesen Epen sofort eine ganz andere Kunst als in den Gedichten von Wolfdietrich. Wir fühlen, daß ihnen alte heroische Lieder und Szenen zugrunde liegen oder Dichtungen, die mit ganz eigener und eindringlicher Kraft alte heroische Themen verwerten.
Der Bote Randolf, der den Dietrich verräterisch einladen soll, und der den jungen Helden doch warnt, erlebt einen Konflikt, wie ihn germanische Helden erleben. Wir erinnern an den Regin der nordischen Sage, der die Söhne Halfdans warnte, obwohl er dem Frodi Treue geschworen. Eine ähnliche verzweifelte Lage wie dem Randolf war auch einem sächsischen Sänger beschieden. Er sollte im Auftrag des Königs Magnus den Herzog Canut einladen. Magnus aber wollte Canut hinterrücks ermorden. Der Sänger wußte das, hatte jedoch vorher dem Magnus geschworen, daß er es nicht verraten werde. Doch die Ahnungslosigkeit des Canut, der nicht einmal ein Schwert nahm, rührte ihn, und da sang er ihm das berühmte Lied der Treulosgkeit der Kriemhild gegen ihre Brüder. Canut aber überhörte die Warnung und ritt in sein Verderben.
Die Dichtung vom Tode der Etzelsöhne reicht wohl auch in die Zeit der Völkerwanderung zurück. Um die Mitte des fünften Jahrhunderts besiegten die germansichen Stämme das Heer der Söhne Attilas und Ellak, der bedeutendste von ihnen, fand dabei den Tod. Die Erinnerung an diesen Sieg wird in der Sage nachgeklungen sein und das Lied von dem Sohn des mächtigen Königs geschaffen haben, der einen grausamen Tod starb.Vielleicht ist der Bericht im Nibelungenlied, in dem ja Hagen den Sohn von Etzel und Kriemhild tötet, auch ein Nachklang eines Liedes dieser Art.
In unserem mittelalterlichen Gedicht von der Rabenschlacht überraschen uns zwei Szenen, weil sie der alten germanischen Kunst entsprechen. Die erste ist die Gegenüberstellung von Etzels Söhnen und ihrem jugendlichen ungestümen Tatendurst und Heldensinn gegen den harten, unbeweglichen Witege. Die andere ist die Verfolgung des Witege durch Dietrich. Sie erscheint uns wie eine Umkehrung des alten Liedes von Chlothars Sieg über die Sachsen. Dort war der Verfolgte der Beredte und Heimtückische, der Verfolger still. Hier scheint der Verfolgte immer noch stiller und verstockter zu werden, und der Verfolger ergeht sich in den leidenschaftlichsten Beschwörungen, Bitten und Klagen. Diese beiden Szenen mögen dem germanischen Lied gehört haben, indem er sie in das Traumhafte und Visionäre steigerte und die gleiche düstere Stimmung des Traumes über das ganze Gedicht breitete, schuf dann ein deutscher Dichter aus der alten germanischen eine mittelalterliche Dichtung von seltsamer rührender und phantastischer Kraft. Wäre sie uns doch selbst erhalten, wie sie der Dichter des Meier Helmbrecht noch kannte, und müßten wir sie doch nicht aus der allzubreiten Umschreibung des Epos von der Rabenschlacht herausholen!
Der bange Traum der Helche leitet das Gedicht ahnungsschwer ein. Nebel verwirrt die Helden und raubt die Jünglinge das erste Mal ihrem alten Erzieher Elsan. Wie ein Traumgesicht von wunderbarer und beseeligender Schönheit taucht Ravenna vor ihnen auf. Unwirklich, wie eine finstere Erscheinung, steht dann plötzlich Witege vor den jungen Helden und tötet einen nach dem anderen. Grausam und ganz gegen die eigene Natur erschlägt Dietrich den Elsan. Die Stummheit und die rasende Flucht des verfolgten Witege wächst immer mehr in das Unheimliche und Traumhafte, so daß wir uns kaum noch wundern, als seine Ahnmutter den Fluten entsteigt und den Sohn rettend zu sich zieht. Die herrenlosen Rosse, die mit blutigen Sätteln auf den Hof der Königsburg laufen, sehen wir wieder vor uns wie die jammervollen Bilder, die ein quälender Traum uns zeigt, und sie sind doch der schmerzliche und milde Nachklang des Gedichtes und geben ihm zugleich durch die Klage der Mutter die rührendste und menschlichste Trauer.
Das alte Gedicht von der Rabenschlacht mag um die Wende des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts entstanden sein. Die Umschreibung, in der wir es besitzen, gehört dem Ende des dreizehnten Jahrhunderts. Wie stark der Eindruck des alten Gedichtes war, erkennt man auch daraus, daß es einem anderen zum Vorbild diente, dem Gedicht von Alpharts Tod. Dies ist seinerseits wohl durch manche Zusätze entstellt, aber auch wenn man es sich davon gereinigt denkt, so steht nur ein Werk der Epigonenkunst vor uns. Besonders in seinem ersten Teil ist es eindrucksvoll und lebendig vorgetragen, und man erkennt darin gute künstlerische Muster und Meister, freilich hält es sich von Übertreibungen, Breiten und Weinerlichkeiten nicht frei. Aus der alten heroischen Überlieferung hat es nirgends geschöpft.
Das Lied schildert, wie der junge Alphart, Hildebrands Neffe, allein auf der Warte gegen Ermenrich reiten will und seinen Willen durchsetzt, obwohl alle Helden der Jugend Alpharts wegen es widerraten. Frau Ute waffnet ihn selbst und läßt ihn dann weinend ziehen, seine junge Frau bittet ihn kniefällig, er möge doch nicht allein ausreiten, aber er küßt sie nur und jagt sie dann davon. Hildebrand will die Kraft des Jünglings prüfen und reitet ihm nach, mißt sich mit ihm, ohne daß er sich zu erkennen gibt, und bereut es bitter; denn der junge Held richtet den Oheim übel zu. Dann begegnet Alphart der Vorhut des Feindes, achtzig Rittern, die er besiegt und tötet, nur acht entfliehen blutend und verbreiten Schrecken in Ermenrichs Lager. Ermenrich verspricht den höchsten Lohn dem Helden, der gegen Alphart kämpfen wolle. Keiner wagt es. Endlich ruft er den Witege und Heime auf. Als Witege kommt, verweist ihm Alphart den Verrat an Dietrich, schleudert ihn aus dem Sattel und streckt ihn auch im Schwertkampf nieder. Wie tot liegt er unter dem Schild. Heime bietet dem Alphart an, er solle zurückkehren, sie wollten sagen, daß sie ihn nicht angetroffen, doch der junge Held verschmäht den Vorschlag, er will Witege zum Pfand. Der hat sich wieder erhoben, erinnert nun den Heime an die Treue, die er ihm geschworen, und beide dringen auf Alphart ein. Als der auch den Heime schwer trifft, brechen die beiden Angreifer das Versprechen, das sie vorher dem Gegner gegeben, Witege fällt ihn von hinten an, Heime von vorne, der junge Held, nach tapferster Gegenwehr, muß sein Leben lassen und verwünscht sterbend die ehrlosen Mörder.
Witege und Heime gehören schon in die germanische Heldensage, denn der altenglische Widsith nennt ihre Namen. Der Held der Geschichte, aus dem der Witege der Dichtung entsprossen, ist einmal der König der Ostgoten Witgis. Wenn man sich erinnert, wie Prokop diesen König schildert, seine Treue, sein tapferes Ausharren in allen Wechselfällen des Kampfes, sein mannhaftes Heldentum und sein Unglück - er mußte sich in Ravenna ergeben -, so versteht man wohl, daß die germanische Heldendichtung diesen König gern besang. Außerdem meint man, daß der tapfere Gotenheld Widigoia, der durch die Hinterlist der Hunnen fiel und nach dem Zeugnis des Jorclanes im Liede gefeiert wurde, in Witege fortlebe. Doch kennen deutsche Heldengedichte des Mittelalters einen eigenen Helden Witegouwe. Ob Heime einem Helden der Geschichte sein Dasein verdankt, wissen wir nicht.
Die beiden, Witege und Heime, waren in den alten Liedern andere als in den deutschen Epen des dreizehnten Jahrhunderts. Selbst in diesen ist die Erinnerung an ihr starres aufrechtes und vorbildliches Heldentum nicht ganz gewichen, und darin muß früher ihr eigentliches Wesen bestanden haben. Wohl durch eine Verwirrung der Sagenerzähler wurden sie aus Helden Dietrichs zu Helden Ermanarichs, und diese Verwirrung hat vielleicht die Vorstellung von ihrer Untreue geschaffen und sie endlich, wie Ludwig Uhland das ausdrückt, in finstere und kalte Mordrecken verwandelt. Das Gedicht von Dietrichs Flucht schiebt den Witege gewissermaßen zwischen Dietrich und Ermanarich hin und her. Witege geht von Ermanarich zu Dietrich über und übergibt dann wieder verräterisch an Ermanarich die Stadt Ravenna, die Dietrich in seiner Hut gelassen. Einen ähnlichen Verrat beging in der Geschichte Odoakers Feldherr Tufa, und es ist nicht ganz ausgeschlossen, daß auch eine Erinnerung daran das Wesen von Witege befleckt hat.
Am ehesten vergleicht sich Witege in seiner Entwicklung wohl dem nordischen Starkad. Beide Helden werden aus Vorbildern der Treue und des Heldentums zu Verrätern. Die wilde Kampflust des Starkad zeigt der Witege der Thidreksaga, und wie Starkad zu einem Wasserriesen, wird Witege zum Sohn einer Meerfrau; auch er steigert sich also in das Mythische.
Die seltene Beliebtheit, die Dietrich von Bern während des ganzen Mittelalters genoß, verdankt er zu einem Teil der heroischen Überlieferung, mit der er verwachsen war und außerdem seiner Persönlichkeit, in der Volk und Helden ihr eigenes Wesen wiederfanden. Denn dem Dietrich blieb seine Langmut und seine Geduld erhalten, ja sie verklärte sich im Lauf der Jahrhunderte und dazu trug wohl das Christentum das Seine bei. Aber auch die Kraft des Dietrich blieb die alte, und wenn er sich zum Kampfe entschloß, war sein Angriff stärker und unwiderstehlicher als der irgendeines anderen Helden, es hieß sogar, daß er mit seinem Feueratem den Gegner versengte.
Das Volk liebte den Dietrich und sang von ihm auch noch aus anderen Ursachen. Es gab ihm nämlich die Freude am Kampf und die Siege, die vorher der alte Gott Donar besaß und die im altenglischen Epos der Beowulf besitzt. Dietrich zeigte sie wie jene im unablässigen, übermächtigen Wirken gegen die Mächte, die die Arbeit des Bauern bedrohen, gegen die Riesen von Wind und Wetter und die anderen Unholde alle. Von diesen Kämpfen erzählen uns eine Fülle von Gedichten aus dem dreizehnten Jahrhundert, von denen einige das Mittelalter überlebten. Leider ist das Volkstümliche und das im germanischen Sinn Mythische aus diesen Liedern fast ganz verdrängt; nur der Riese Fasolt und die böse, Steine und Lawinen schleudernde Riesin Runze entstammen dem alten Volksglauben. Sonst sind die alten Sagen durch Erfindungen und Erzählungen im höfischen Geschmack und nach den höfischen Vorbildern der Artusdichtung ersetzt oder überwuchert.
Die Kunst der Spielleute drang natürlich auch in sie hinein. Dabei wurde auch die alte schwere Bedeutung der Kämpfe vergessen; so wie die Dichter des dreizehnten Jahrhunderts sie erzählen, sollen sie nur unterhalten, wie eben die höfischen Romane unterhielten. Da besiegt der Riese Sigenot den Berner, und Hildebrand befreit ihn nach schwerem Kampf, oder Dietrich hilft der Bergkönigin Virginal vor den Riesen, die sie bedrängen, oder es dringen Dietrich und seine Helden in das Reich des Laurin, das mit einem Seidenfaden umgeben ist und das kein Irdischer betreten darf; sie wollen aber den Zwerg strafen, weil er die Künhilt, die Schwester eines ihrer Helden, entführt.
Laurin wird erst besiegt, als sie ihm seinen Gürtel abreißen, der ihm die Stärke von zwölf Männern verlieh. In dem Reich des Zwergkönigs werden die Helden herrlich bewirtet und weiden sich an dem funkelnden Glanz und der Pracht, die sie überall umgibt. Dann aber bezaubert und fesselt der tückische Zwerg die Helden und nur durch die Hilfe der entführten Künhilt werden sie wieder sehend und überwinden noch einmal ihren hinterlistigen Wirt.
Den Inhalt des hübschesten und beliebtesten dieser Gedichte, den Inhalt des Eckenliedes, teilen wir wieder mit Ludwig Uhlands Worten mit:
Auf Jochgrimm sitzen drei königliche Jungfrauen. Sie haben Dietrichs Lob vernommen und wünschen sehnlich, ihn zu sehen. Drei riesenhafte Brüder, Ecke, Fasolt und Ebenrot, werben um die Jungfrauen. Ecke, kaum achtzehn Jahre alt, hat schon manchen niedergeworfen; sein größter Kummer ist, daß er nichts zu fechten hat. Ihn verdrießt, daß der Berner vor allen Helden gerühmt wird, und er gelobt, ihn gutlich oder mit Gewalt, lebend oder tot herzubringen. Zum Lohne wird ihm die Minne einer der Königinnen zugesagt. Seeburg, die schönste, schenkt ihm eine herrliche Rüstung, womit sie selbst ihn wappnet. Auch ein treffliches Roß läßt sie ihm vorziehen, aber ihn trägt kein Pferd, und er braucht auch keines, vierzehn Tage und Nächte kann er gehen ohne Müdigkeit und Hunger. Zu Fuß eilt er von dannen über das Gefild, in weiten Sprüngen, wie ein Leopard; fern aus dem Walde noch, wie eine Glocke, klingt sein Helm, wenn ihn die Äst rühren. Durch Gebirg und Wälder rennend, schreckt er das Wild auf; es flieht vor ihm oder sieht ihm staunend nach, und die Vögel verstummen. So läuft er bis nach Bern und, als er dort vernimmt, daß Dietrich ins Gebirg geritten, wieder an der Etsch hinauf in einem Tage bis Trient.
Den Tag darauf findet er im Walde den Ritter Helfrich mit Wunden, die man mit Händen messen kann: Kein Schwert, ein Donnerstrahl scheint sie geschlagen zu haben. Drei Genossen Helfrichs liegen tot. Der Wunde rät Ecken, den Berner zu scheuen, der all den Schaden getan. Ecke läßt nicht ab, Dietrichs Spuren zu verfolgen. Kaum sieht er ihn im Walde reiten, als er ihn zum Kampfe fordert. Dietrich zeigt keine Lust, mit dem zu streiten, der über die Bäume ragt. Ecke rühmt seine köstlichen Waffen, von den besten Meistern geschmiedet, Stück für Stück, um durch Hoffnung dieser Beute den Helden zu reizen. Aber Dietrich meint, er wäre töricht, sich an solchen Waffen zu versuchen. So ziehen sie lange hin, der Berner ruhig zu Roß, Ecke nebenher schreitend und inständig um Kampf flehend. Er droht, Dietrichs Zagheit überall zu verkünden, er mahnt ihn bei aller Frauen Ehre, er gibt dem Gegner alle Himmelsmächte vor.
Endlich willigt der Berner ein, am Morgen zu steilen. Doch Ecke will nicht warten, er wird nur dringender. Schon ist die Sonne zu Rast, als Dietrich vom Rosse steigt. Sie kämpfen noch in der Nacht; das Feuer, das sie aus den Helmen schlagen, leuchtet ihnen. Das Gras wird vertilgt von ihren Tritten, der Wald versengt von ihren Schlägen. Sie schlagen sich tiefe Wunden, sie ringen und reißen sich die Wunden auf. Zuletzt unterliegt Ecke. Vergeblich bietet Dietrich Schonung und Genossenschaft, wenn jener das Schwert abgebe. Ecke trotzt und zeigt selbst die Fuge, wo sein Harnisch zu durchbohren ist. Dietrich beklagt den Tod des Jünglings, nimmt dessen Rüstung und Schwert Eckesachs, das er seitdem führt, und bedeckt den Toten mit grünem Laube.
Dann reitet er hinweg, blutend und voll Sorge, man möchte glauben, er habe Ecke im Schlaf erstochen. Schwere Kämpfe besteht er noch mit Eckes Bruder Fasolt, der mit wilden Hunden eine Jungfrau durch den Wald hetzt, und mit dem übrigen riesenhaften Geschlechte, namentlich der wilden Runze, die lawinengleich eine Berglehne herabsaust und mit einer Hand eine ganze Burg wegfegt. Das Haupt Eckes führt er am Sattelbogen mit sich und bringt es den drei Königinnen, die den Jüngling in den Tod gesandt.
Die Dichtungen von Wolfdietrich und Dietrich von Bern sind sich auch darin verwandt, daß sie Abenteuer und Fabeleien nach Art der höfischen und Spielmannsdichtung auf einen alten Helden und auf seine heroischen Kämpfe übertragen. Die Gedichte über Dietrich von Berns wunderbare Kämpfe und Erlebnisse stehen aber frei und locker nebeneinander, sie verschlingen sich nicht wie bei Wolfdietrich zu einer Einheit, die dann doch keine Einheit ist. Darum wird das Wesen des Dietrich von Bern auch von diesen Abenteuern nicht erdrückt, es hat sich auch hier alles in allem in großer Reinheit erhalten.
Die Frömmigkeit und Einfalt der Legende fehlt den mythischen Gedichten von Dietrich von Bern, und vom Märchen lebt mehr das Phantastische, wunderbar Verwirrende als das Kindliche in ihnen. Am meisten aber entzückt in ihrer Kunst die Schilderung der Natur. Im Ortnit und im Wolfdietrich fanden wir auch Szenen von einer Freude an der Natur und von einer Gabe, ihre Lieblichkeit und Größe wiederzugeben, die wir vorher in der Heldendichtung noch nicht endeckten, wir erinnern uns etwa an die Szene, in der Ortnit unter der Linde auf blühendem Anger den Albrich entdeckt, oder an die Geschichte vom Knäblein Wolfdietrich, das an dem von Seerosen bewachsenen Teich sitzt und den Wölfen in ihre glühenden Augen faßt, oder an den Weg Wolfdietrichs, den Abhang o herunter zum Meer. Anschaulicher und großartiger noch ist die Natur in den Gedichten von den Abenteuern Dietrichs erfaßt, und wir können die Art dieser Schilderungen wieder nicht besser erzählen als mit den Worten Ludwig Uhlands.
"Im Eckenliede rauscht noch immer der unbändige Sturmgeist, zum Schrecken der Vöglein und alles Getieres, durch die krachenden Bergwälder. Selbst in dem späten Dichtwerke Virginal waltete noch immer, mitten unter dem geziertesten Hofwesen, ein reger Sinn für die großartige Gebirgswelt, deren gewaltsamtste Erscheinungen als Riesenvolk und Drachenbrut dargestellt sind. Die Abenteuer bewegen sich im wilden Lande Tirol, im finsteren Walde, darin man den hellen Tag nicht spürt, wo nur enge Pfade durch tiefe Tobel, Täler und Klingen führen, zu hochragenden Burgfesten, deren Grundfels in den Lüften zu hängen scheint; wo der Verirrende ein verlorener Mann ist, der einsam Reitende sich selbst den Tod gibt. Dort, wo ein Bach vom hohen Fels her bricht, da springt der grimmige Drache, Schaum vor dem Rachen, fort und fort auf den Gegner los und sucht ihn zu verschlingen; wieder ,bei eines Brunnen Flusse' vor dem Gebirg, das sich hoch in die Lüfte zieht, schießen große Würmer her und hin und trachten, die Helden zu verbrennen; bei der Herankunft eines solchen, der Roß und Mann zu verschlingen droht, wird ein Schall gehört, recht wie ein Donnerschlag, davon das ganze Gebirg ertost. Leicht erkennbar sind diese Ungestüme gleichbedeutend mit den siedenden donnernden Wasserstürzen selbst. Dazwischen ertönt, ebenso donnerartig, das gräßliche Schreien der Riesen; als Dietrich mit tödlichem Steinwurf einen jungen Riesen getroffen hatte, stößt dieser einen so grimmen Schrei aus, als bräche der Himmel entzwei, und seine Genossen erheben eine Wehklage, die man vier Meilen weit über Berg und Tann vernimmt, die stärksten Tiere fliehen aus der Wildnis, es ist, als wären die Lüfte erzürnt, der Grimm Gottes im Kommen, der Teufel herausgelassen, die Welt verloren, der jüngste Tag angebrochen; ein starker Riese ,Felsenstoß' läßt seine Stimme gleich einer Orgel erdröhnen, man hört sie über Berg und Tal, überall erschrecken die Leute, und selbst der sonst unersättliche Kämpe Wolfhart meint, die Berge seien entzwei, die Hölle aufgeweckt, alle Recken sollen flüchtig werden; auch die Riesen hausen am betäubenden Lärm eines Bergwassers, bei einer Mühle und zunächst einer tiefen Höhle."
Die Kirche war dem Dietrich von Bern von jeher abhold; sie hat ihn zuerst gehaßt, weil er ein Ketzer war, und dann, weil das Volk so leidenschaftlich an ihm hing. Es gab von dem König eine Sage, daß er nicht gestorben, sondern in einen Berg entführt sei, wo er nun schlafe. Diese verwandelte die Kirche: Den Dietrich habe ein schwarzes Roß, und das war niemand anderes als der Teufel selbst, entführt und ihn in den Ätna getragen, in dessen Feuergluten er seine Sünden noch immer büßen müsse. Aber wie oft diese alte Erzählung auch wiederholt und dem Volke vorgehalten wurde, aus seinem Herzen hat sie diesen König nie reißen können. Und so vermehrt gerade sie unser Staunen und unsere Rührung darüber, daß Jahrhunderte diesem treuesten König die Treue hielten und ihn als das verklärte Abbild des eigenen Wesens liebten. Zum Schluß führen alle Sagen von Dietrich von