Eliminativer Materialismus. Ist Bewusstsein nur eine Illusion?
30.04.2025 um 19:07Versuch dich in deinem nächsten Beitrag an mich von diesem Bodensatz an Qualität zu verabschieden.Noumenon schrieb:Du stammelst was von
Versuch dich in deinem nächsten Beitrag an mich von diesem Bodensatz an Qualität zu verabschieden.Noumenon schrieb:Du stammelst was von
Versuche doch einfach mal, was zur Sache zu sagen, anstatt Spitzfindigkeiten als Ausrede zu nehmen.shakazulu2 schrieb:Versuch dich in deinem nächsten Beitrag an mich von diesem Bodensatz an Qualität zu verabschieden.
Und ich habe erläutert, dass du hier einen Strohmann aufbaust. Auf das Qualiaproblem gehst du überhaupt nicht ein. Um das zu sehen, muss man nicht lange nachdenken. Soviel zur Zielsetzung..shakazulu2 schrieb:Ich habe dir in meinem letzten Beitrag drei Fragen gestellt, du bist auf nichts eingegangen, sondern hast ohne Nachzudenken (man erkennt dies am zeitlichen Abstand) eine unpassende Reaktion gebracht.
Das verdeutlicht wieder deine Zielsetzung.
q.e.d.
Wikipedia: QualiaEigentlich ist "subjektives Erleben" ein "weisser Schimmel" und damit eine unnötige Formulierung.
Unter "Qualia" wird der subjektive Erlebnisgehalt mentaler Zustände verstanden.
Hier von "blumigen Spracheinlagen" und "Wortakrobaten" zu sprechen, hat eine gewisse Ironie, denn da sind "wir" nicht allein.shakazulu2 schrieb:Diese ganzen Ungünstigkeiten in der Anfangsformulierung (man kann es ruhig als unmittelbare Suggestionen einstufen) sind ein Nährboden für blumige Phänomenvorstellungen und genauso blumige Spracheinlagen und die derart begeisterten User hier im Forum haben dies ja bereits unter Beweis gestellt.
Am Ende des Tages fragen sich solche Wortakrobaten dann, wie "das Phänomen" (also ihr "jeweils gewähltes Phänomen" - sie stellen sich dazu immer vor "das Problem genau erkannt zu haben") in die materielle Welt passt und stricken sich das sonderbare "Argument", "dass es dort ja auch ohne ging und es deshalb um eine neue Existenz, eine Phänomenalexistenz, gehen muss".
Die Definition von Qualia ist eigentlich ziemlich klar und eindeutig. In der Philosophie wird eben alles regelrecht seziert und in verschiedenen Tiefen vorgedrungen. Hat natürlich vor- und Nachteile. Die Philosophie fragt eben genauer. Wo fängt Qualia an, wie entsteht sie, warum entsteht sie, usw.... Aber Qualia an sich, ist eigentlich ziemlich klar definiert, auch wenn wir Menschen das individuelle Anfühlen des Erlebten, was Qualia ausmacht, nicht gänzlich in Worte fassen können. Dadurch kommt es oft zur Verwirrung.shakazulu2 schrieb:Die philosophische Formulierung von "Qualia" ist aber halt so schwammig, dass sich ein regelrechtes Spektrum ergibt, was denn nun das Phänomen sein soll:
Nö, die Verwirrung kommt eher daher, dass du aus einer Reihe von Punkten (die ich oben angegeben habe) keinen einzigen aussuchst, die Liste auch nicht erweiterst, sondern stattdessen auf "das individuelle Anfühlen des Erlebten" abbiegst, was noch schräger ist als „subjektiver Erlebnisgehalt mentaler Zustände“.Flitzschnitzel schrieb:Aber Qualia an sich, ist eigentlich ziemlich klar definiert, auch wenn wir Menschen das individuelle Anfühlen des Erlebten, was Qualia ausmacht, nicht gänzlich in Worte fassen können. Dadurch kommt es oft zur Verwirrung.
Wieso sollte ich auch. Ich habe es damit herunter gebrochen. Deine Punkte beschreiben eben keine Qualia. Da es heruntergebrochen, ums individuelle Anfühlen geht. Nicht um die Farbe an sich, nicht um eine Oberfläche, nicht um das Erleben an sich usw., sondern um das wie etwas erlebt wird. Versuche diesen Grund erst zu erfassen, bevor du zum sezieren kommst. Sonst wird es meist zu wirr. Wärst nicht der erste und auch nicht der letzte.shakazulu2 schrieb:Nö, die Verwirrung kommt eher daher, dass du aus einer Reihe von Punkten (die ich oben angegeben habe) keinen einzigen aussuchst, die Liste auch nicht erweiterst, sondern stattdessen auf "das individuelle Anfühlen des Erlebten" abbiegst, was noch schräger ist als „subjektiver Erlebnisgehalt mentaler Zustände“.
Nö. Du bleibst weiter die Übersetzungsleistung Vorgang im Nervensystem <-> Bewusstseinsinhalt schuldig. Du eierst nur endlos rum um dich dem ja nicht stellen zu müssen. Ohne diese Transferleistung bleibt es aber weiter völlig schnurz was das Nervensystem so tut. Zumindest wenn es um Qualia geht.shakazulu2 schrieb:Man muss keine Qualia beschreiben (das geht ja nicht, sonst wäre der Begriff "Phänomen" falsch), man muss die Methode des Nervensystems herausbekommen - dort liegt der Aha-Effekt.
Weder ist Schmerz abstrakt, noch hat ein Körper eine Wahrnehmung, noch verwaltet sich der Körper. Du hopst entspannt durch viele Sprachebenen ohne klar machen zu können, wie das gehen soll.shakazulu2 schrieb:Ich habe zur Formulierung "der Schmerz" angegeben, dass dies ein abstrakter Begriff ist, denn tatsächlich geht es darum, dass sich der Körper in seiner Wahrnehmung als "(in einer konkreten Form) belastet anfühlend" verwaltet.
Ja mei, such es dir aus. Übersetz irgendeins deiner Beispiele in einen neuronalen Vorgang und wieder zurück. Das ist dir schon beim Schmerz missglückt und solange du das nicht lieferst, wird dich auch keiner für voll nehmen.shakazulu2 schrieb:soll es "die Farbe" sein?
soll es […]
Mit dem "XYZ an sich" und dem "wie XYZ erlebt wird" ziehst du eine eigenartige Trennlinie ein, aber gut.Flitzschnitzel schrieb:Nicht um die Farbe an sich, nicht um eine Oberfläche, nicht um das Erleben an sich usw., sondern um das wie etwas erlebt wird.
https://idw-online.de/de/news294779Die Behauptung eines zusätzlichen phänomenalen Inhalts soll sich in der "gängigen These" (laut diesem Text) um das "Sich-Anfühlen des Blau-Erlebnisses" drehen.
Bewusste Erlebnisse fühlen sich irgendwie an - wir sehen den blauen Himmel oder genießen die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut. Warum das so ist, beantworten viele Philosophen so: Jedes Erleben hat einen bestimmten Inhalt - wenn wir also das Blau des Himmels erleben, erleben wir den Inhalt "Der Himmel ist blau". Hinzu kommt ein phänomenaler Inhalt, der die subjektive Dimension der Wahrnehmung, also wie sich das Blau-Erlebnis für jeden einzelnen anfühlt, bestimmt.
https://idw-online.de/de/news294779Das mit "den Inhalten" scheint man in der Philosophie nicht wirklich im Griff zu haben.
Dieser gängigen These widersprechen die Bochumer Philosophen Dr. Gottfried Vosgerau, Dr. Tobias Schlicht und Prof. Dr. Albert Newen (Institut für Philosophie) entschieden - in ihrer eigenen, dynamischen Theorie stellen sie stattdessen die Verarbeitung des Inhalts in den Mittelpunkt des bewussten Erlebens.
...
Wenn die Inhalte nicht entscheidend sind für das Bewusstsein, bedeutet das außerdem, dass die subjektive Qualität des Erlebnisses bei unterschiedlichen Menschen nicht radikal verschieden sein kann; dass die bewusste Wahrnehmung also streng genommen bei allen Menschen sehr ähnlich ist.
....
Ein Inhalt wird erst dann bewusst, wenn er in einen größeren Zusammenhang integriert wird, wenn man zum Beispiel darüber reden oder nachdenken kann.
Nun, es geht jetzt um deine Aussage - passt du sie an?Flitzschnitzel schrieb:Schritt für Schritt. Dieses Thema kann sehr tief sein.
Nicht wirklich. Denn genau diese Trennung ist zentral bei der Qualia Debatte. Von dem Erleben an sich (zB. das Sehen einer roten Blume als kognitive / funktionale Tatsache), zu dem "Wie" des Erlebens (zB. wie sich das Sehen von Rot anfühlt, also die Qualia). Das sind zwei Paar Schuhe. Ohne diese Trennung wird es unpräzise.shakazulu2 schrieb:Bei Qualia soll es also bei der gängigen These nicht um eine Trennung von "Erleben an sich" und "wie etwas erlebt wird" gehen, sondern darum, dass es nur ganz bestimmtes Erleben geben soll, das ein Wie-Phänomen ins Spiel bringen kann.
Muss man ja nicht. Ist eben Gedankenakrobatik. Aber wenn du tatsächlich dem auf den Grund fühlen willst, ist diese Einstellung nicht von Vorteil.shakazulu2 schrieb:(wie das alles zusammen gerätselt wurde, ist mir vollständig unbekannt und ich glaube, ich will es gar nicht wissen)
In der Philosophie ist eben alles kontrovers, bis auf eine Sache. Ganz normal. Wäre anders auch langweilig. Es ist eben die Liebe zur Weisheit, was das Wort Philosophie auch bedeutet. Weisheit fällt einem selten einfach so zu, sondern muss erlangt werden.shakazulu2 schrieb:Das mit "den Inhalten" scheint man in der Philosophie nicht wirklich im Griff zu haben.
Problematische Formulierung. Da es kein Erleben ohne ein "sich anfühlen" gibt. Man kann sie zwar gedanklich Unterscheiden, aber sie können im Erleben nicht völlig getrennt werden.shakazulu2 schrieb:Man muss es wohl so sehen: das "Himmel ist Blau"-Erleben soll frei von einem "Sich-Anfühlen" (also von einem "Wie") sein.
Erst das "Blau"-Erleben soll die Zutat des "Sich-Anfühlens" enthalten.
Kommt beides Erleben zusammen, dann ist es "bewusstes Erleben".
So so.Flitzschnitzel schrieb:Da es kein Erleben ohne ein "sich anfühlen" gibt.
D.h. du gestehst ein, dass die von dir eingezogene Trennlinie tatsächlich eigenartig ist?Flitzschnitzel schrieb:Man kann sie zwar gedanklich Unterscheiden, aber sie können im Erleben nicht völlig getrennt werden.
Das hatte ich teilweise schon geschrieben:shakazulu2 schrieb:Was genau soll dann "Erleben an sich" sein, wenn es in Bezug auf dieses "Sich-Anfühlen" gar kein "an sich" gibt?
Versteh mich nicht falsch, das eine ist das rein Technische, das andere ist das Endprodukt. Dieser Vorgang geht so schnell dass wir Menschen darauf keinen Einfluss haben. Deshalb keine Trennung im Erleben. Wohl aber kann man gedanklich eine Trennung vollziehen. Was auch angebracht ist. Wenn du Blau siehst, ist der ganze Prozess schon durch. Da ist nichts mit, langsamen sehen/fühlen usw.Flitzschnitzel schrieb:Von dem Erleben an sich (zB. das Sehen einer roten Blume als kognitive / funktionale Tatsache), zu dem "Wie" des Erlebens (zB. wie sich das Sehen von Rot anfühlt, also die Qualia). Das sind zwei Paar Schuhe. Ohne diese Trennung wird es unpräzise.
Solange das "harte Problem des Bewusstseins" nicht gelöst ist, könnte vieles sein. Aber eines ist sicher, wer sich von vornherein bei Dingen festlegt, ohne tatsächliches Wissen, trinkt öfter mal einen Becher Torheit.shakazulu2 schrieb:Ist "sich anfühlendes Erleben" ein "weisser Schimmel"?
Bewusstsein an sich ist eigenartig. Diese Trennlinie stammt nicht von mir. Aber ich kann sie zumindest nachvollziehen, da sie berechtigte Fragestellungen aufgreift, die sich rein materialistisch (noch?) nicht gänzlich erklären lassen. Und nein, weiter will ich nicht gehen. Solange vorheriges nicht nachvollziehbar ist.shakazulu2 schrieb:D.h. du gestehst ein, dass die von dir eingezogene Trennlinie tatsächlich eigenartig ist?
Nein, die Trennung ist keine Aufteilung in "rein Technisch" und "Endprodukt", sondern eine unmittelbare philosophische Erfindung.Flitzschnitzel schrieb:Versteh mich nicht falsch, das eine ist das rein Technische, das andere ist das Endprodukt. Dieser Vorgang geht so schnell dass wir Menschen darauf keinen Einfluss haben. Deshalb keine Trennung im Erleben. Wohl aber kann man gedanklich eine Trennung vollziehen.
Es ist leicht erkennbar, dass es hier zum einen um eine Analyse-/Beschreibungs-/Wissenssituation geht und zum anderen um eine Konfrontationssituation.Flitzschnitzel schrieb:Oder wie Tomas Nagel sagen würde, wir können alles über das Gehirn, die Biologie und das Verhalten einer Fledermaus wissen. Aber wir werden niemals wissen, wie es sich tatsächlich anfühlt, eine Fledermaus zu sein – also wie das subjektive Erleben von Echoortung, Fliegen, Hängen usw. ist.
Deswegen versuchen viele in der Philosophie diese Trennung zu machen...
Natürlich stammt das nicht von dir (bis vielleicht auf die Behauptung des "zeitlichen Versatzes"), ich habe es mit der Angabe des Universitäts-Textes ja explizit als "offiziellen Bestandteil der Philosophie" angegeben.Flitzschnitzel schrieb:Diese Trennlinie stammt nicht von mir. Aber ich kann sie zumindest nachvollziehen, da sie berechtigte Fragestellungen aufgreift, die sich rein materialistisch (noch?) nicht gänzlich erklären lassen.
Meine Fragen sind sinnvoll und sie wirken genau dort, wo es wehtut.Flitzschnitzel schrieb:Und nein, weiter will ich nicht gehen. Solange vorheriges nicht nachvollziehbar ist.
Wenn ich mir den philosophischen Unterbau zu diesem "harten Problem des Bewusstseins" anschaue, dann solltest du auch schlicht in Betracht ziehen, dass du einer falschen Fragestellung nachjagst.Flitzschnitzel schrieb:Solange das "harte Problem des Bewusstseins" nicht gelöst ist, könnte vieles sein. Aber eines ist sicher, wer sich von vornherein bei Dingen festlegt, ohne tatsächliches Wissen, trinkt öfter mal einen Becher Torheit.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Daher: Schmerz ist nicht gleich Nervenreiz. Schmerz ist nicht gleich Verhalten. Schmerz ist auch nicht gleich Bewertung.
Und ich habe den Verdacht, dass du allenfalls oberflächlich an einer ernsthaften und sachlichen Diskussion interessiert zu sein scheinst. Vielleicht täusche ich mich da auch, aber du reißt Aussagen scheinbar gerne mal aus dem Kontext und ignorierst den Diskussionsverlauf, um dann derartige Strohmänner zu basteln. Wozu diese Aussage, fragst du...? Nun, es steht doch da, es geht aus dem Kontext und dem Diskussionsverlauf hervor!shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Wozu diese Aussage?
Wir haben doch vor wenigen Beiträgen ausgetauscht, dass ich keine derartigen Gleichsetzungen mache.
Wieso legst du mir immer wieder dieses Zeugs vor?
Ich habe den Verdacht, dass du alles, was ich schreibe nur in dieser Richtung zu verstehen versuchst - das ist sehr preisgünstig.
Noumenon schrieb am 20.04.2025:Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es sich bei "Schmerz" (oder "Schmerzerleben") um ein reales Phänomen handelt und kenne darüber hinaus auch seine qualitative Dimension (d.h. ich weiß, wie sich Schmerzen anfühlen), ein chirurgischer Roboter hingegen nicht (jedenfalls nicht notwendigerweise).
shakazulu2 schrieb am 21.04.2025:"Schmerz" ist leider nur ein abstrakter Begriff.
Was genau meinst du?
Mache es konkret:
Beispiel 1: [...]
Beispiel 2: [...]
Beispiel 3: [...]
Beispiel 4: [...]
Noumenon schrieb am 22.04.2025:Naja, sind ja durchaus interessante Beispiele, also gehen wir das mal in Ruhe durch.
[...längere Ausführungen zu den genannten Beispielen, wie gefordert...]
Alle vier Beispiele unterscheiden sich letztendlich in Ursache, Kontext und Bewertung. Schmerz ist aber nicht gleich Nervenreiz, nicht gleich Verhalten, nicht gleich Modellbildung. Schmerz ist subjektives Erleben, das sich im Bewusstsein manifestiert. Und zwar auch dann, wenn es keine äußere Ursache gibt. Genau dieses Erleben ist das, worum es hier gerade geht. Dass es nicht vollständig lokalisiert, erklärt oder gemessen werden kann, mindert nicht seine Realität, sondern macht es gerade zu einem philosophisch zentralen Problem, dem sog. Qualiaproblem.
shakazulu2 schrieb am 23.04.2025:Erinnerst du dich, dass du mir derartige Gleichsetzungen nicht vorwerfen musst, da ich sie nicht mache?
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Ja, aber was du unter "Schmerz" zu beschreiben versuchst, ist bei näherem Hinsehen gar nicht Schmerz, sondern lediglich die (korrekte) "Verwaltung von Belastungsinformationen" innerhalb eines sensomotorischen Systems. In deiner Darstellung ist Schmerz keine erlebte Qualität, kein subjektiver Zustand, sondern ein Funktionselement der Körperorganisation, ein "Verarbeitungsergebnis" neuronaler Signale. Damit beschreibst du aber nicht Schmerz, sondern die Ursache, die Struktur oder die Reaktionslogik, die mit Schmerz zusammenhängen können, aber den Schmerz selbst nicht ausmachen. Daher: Schmerz ist nicht gleich Nervenreiz. Schmerz ist nicht gleich Verhalten. Schmerz ist auch nicht gleich Bewertung. Schmerz ist - wenn überhaupt - eben das, was sich wie Schmerz anfühlt. Und solange diese fühlbare Dimension in deiner Darstellung nicht auftaucht, sprichst du über etwas anderes, über alles Mögliche, nur eben nicht Schmerz. Wer also Schmerz auf bloße "Verwaltung körperlicher Belastung" reduziert, beschreibt keine subjektive Erfahrung, sondern eine logistische Leistung des Nervensystems. Das Problem der Phänomenalität hast du damit nicht gelöst, sondern bloß kaschiert, um nicht zu sagen ignoriert.
Du hättest hier auf die entscheidenden Kritikpunkte eingehen können, hast du nicht gemacht, also drehen wir uns munter weiter im Kreis. Aber macht ja nix...shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Wozu diese Aussage?
Wir haben doch vor wenigen Beiträgen ausgetauscht, dass ich keine derartigen Gleichsetzungen mache.
Wieso legst du mir immer wieder dieses Zeugs vor?
Ich habe den Verdacht, dass du alles, was ich schreibe nur in dieser Richtung zu verstehen versuchst - das ist sehr preisgünstig.
Doch, ich habe deine Ausführungen sehr gut verstanden, auch zuvor schon. Bspw. möchtest du den Begriff "Überzeugung" nicht psychologisch oder epistemologisch im herkömmlichen Sinn verstanden wissen, sondern als (funktionale) Reaktion eines selbstlernenden Nervensystems auf körperlich-situative Aufgaben- oder Problemstellungen. Das subjektive Erleben (bspw. Schmerz) ist demnach nicht "etwas, das da ist", sondern das Ergebnis eines Reaktionsprinzips, d.h. die plausibelste Reaktion des Körpers auf interne Signale, die in einer bestimmten Situation auftreten. Und damit lässt sich zwar vielleicht erklären, warum eine Überzeugung gebildet wird, aber nicht, warum diese Überzeugung phänomenalen Charakter hat, also sich "so und nicht anders" anfühlt. Du kannst allenfalls erklären, dass eine Reaktion erfolgt, aber nicht, warum sie erlebt wird. Das ist der berühmte Unterschied zwischen funktionaler Rolle und qualitativer Erfahrung, d.h. selbst wenn (subjektives) Erleben funktional als Überzeugung konstruierbar ist, bleibt die Frage: Warum ist diese Überzeugung mit einem phänomenalen Erleben verknüpft? Warum ist "Ich habe Schmerz" gefühlt und nicht nur gedacht...? Solange du nicht erklärst, warum und wie die Überzeugung letztendlich Erleben konstituiert, beschreibst du lediglich das äußere Verhalten des Systems, nicht dessen innere Erlebnisstruktur (siehe etwa Thomas Nagel "How its like to be a bat?").shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Also nochmal: mir geht es darum, dass es zu Überzeugungen kommt, aber nicht zu dem Zeugs, wovon man überzeugt ist.
Auf dem Weg dorthin werden keine Impulse und keine Impulsverteilung für ein Phänomenaldingens gehalten.
Halte einfach mal kurz inne und mach dir diesen Punkt klar, denn dann wirst du darin (also exakt: darin) den Aspekt des Phänomens vorfinden.
Wenn nur Überzeugungen stattfinden, aber nie das Ding selbst vorliegt, dann bleibt das Ding ein Phänomen, denn es kann nicht erreicht werden.
Ich bin damit von uns beiden der einzige, der den Phänomenalcharakter direkt begründen kann und explizit im Konzept enthalten hat.
Wieso in deinem Ansatz ausgerechnet eine Existenz, also etwas Vorliegendes (analog zu einem Tisch), ein Phänomen sein soll, hast du dich bestimmt noch nie gefragt.
Wenn etwas vorliegt, dann ist es für den Menschen gerade kein Phänomen mehr.
Ich denke, du solltest dich erheblich zurückhalten mit deinen Vorwürfen gegen meine Aussagen.
Geh vielleicht lieber davon aus, dass du meine Aussagen nicht verstanden hast, als dass du weiterhin mit dem Gleichsetzungszeugs glänzen möchtest.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Wer also Schmerz auf bloße "Verwaltung körperlicher Belastung" reduziert, beschreibt keine subjektive Erfahrung, sondern eine logistische Leistung des Nervensystems. Das Problem der Phänomenalität hast du damit nicht gelöst, sondern bloß kaschiert, um nicht zu sagen ignoriert.
Siehe oben.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Hä, wieso sollte die Überzeugung "subjektiver Erfahrung einer belasteten Zahnregion" keine Verwaltung körperlicher Belastung sein - es ist doch nichts anderes und vor allem: es passt exakt zum Körper und seiner Situation.
Bestimmt hast du wieder die Gleichsetzungsidee im Kopf und lehnst damit jedes Wort von mir ab.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Ich muss das Bindungsproblem nicht lösen
Wieder meine Aussage aus dem Kontext gerissen. Noch einmal:shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Doch, weil du das Aktivitätsmuster im Nervensystem als Ausgangspunkt für den "Sprung ins Phänomenale" angegeben hast.
Du hast geschrieben "Das zeigt: Schmerz ist kein direktes Abbild von Realität, sondern ein Bewusstseinsinhalt, der auf bestimmten Aktivitätsmustern beruht"
D.h. du benötigst das Muster, und zwar als Gesamtheit.
Also: durch was in diesem Raumzeit-Kontinuum wird aus einer sehr stark verteilten und sich im Millisekundenbereich ändernden neuronalen Aktivität eine Grundlage, auf der "ein Bewusstseinsinhalt beruhen" kann?
Du musst hierfür das Bindungsproblem lösen. Irgendwo muss in deiner Behauptungswelt eine Fähigkeit zum Überblick vorhanden sein, um die Aktivitätsverteilung als Muster zu "behandeln" und dann zur Phänomenalexistenz "überzugehen".
Beschreibe bitte diese Fähigkeit, du hast den grundlegenden Vorgang ja angedeutet.
Noumenon schrieb am 22.04.2025:In diesem Fall liegt der Ursprung des Schmerzes im Gehirn, nicht im Zahn. Dennoch wird der Schmerz als Zahnschmerz erlebt. Das zeigt: Schmerz ist nicht einfach die direkte Reaktion auf eine lokale Ursache, sondern ein phänomenales Erlebnis, welches entstehen kann, sobald bestimmte neuronale Bedingungen erfüllt sind, selbst wenn diese Bedingungen nicht passend zur vermeintlichen Reizquelle erscheinen. Daraus folgt: Das Erleben von Schmerz ist nicht dasselbe wie seine Ursache, die Zahnschmerzen entstehen durch neurale Fehlinterpretation. Die Qualia sind real, selbst wenn die Ursache irreführend ist. Die Ursache ist bspw. durch physikalische Prozesse beschrieben, wie das Drücken eines Gefäßes auf einen Nerv. Aber das phänomenale Erleben ("wie sich das anfühlt", also als "Zahnschmerz") ist etwas, das nicht in diesen physikalischen Beschreibungen enthalten ist, d.h. es ist nicht einfach identisch mit der Ursache oder dem funktionalen Ablauf, es ist zwar damit verknüpft, aber geht darüber hinaus.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Du wirfst mir nun aber vor allem auch vor (Behauptung), ich würde eine "Entstehung von Existenz" behaupten.
Achso, ja, verstehe, worauf du hinauswillst. Nur ist die Sache ziemlich simpel: In einem Moment ist jemand noch schmerzfrei, wenig später hat er "plötzlich" Zahnschmerzen, irgendetwas hat also irgendwie zum Phänomen "Zahnschmerzen" geführt. Was genau möchtest du da jetzt von mir wissen? Das ist eine reichlich banale Feststellung, keine Behauptung. Vielmehr würde ich mich deiner Frage anschließen: Wie und warum kommt es hier zum "Entstehen von Phänomenalexistenz"...? Genau das ist ja der Kern des Qualiaproblems.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Du hast geschrieben: "ein phänomenales Erlebnis, welches entstehen kann, sobald bestimmte neuronale Bedingungen erfüllt sind"
Also die Phänomenalexistenz soll entstehen können, sobald bestimmte neuronale Bedingungen erfüllt sind.
Sorry, schreib es halt nicht, wenn du nicht damit konfrontiert werden möchtest.
Du hast es geschrieben, also klären wir nun das "Entstehen von Phänomenalexistenz" ab.
Schreib im nächsten Beitrag alles rein, was du weisst.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Du versuchst nun in einem zweiten Schritt, diesen Umstand irgendwie als einen "Widerspruch in der Realität" zu brandmarken, aber das ist ein Kategorienfehler: "Realität" setzt du mit einer physikalisch korrekten Lokalisation von Reizursachen gleich. Und wenn das Erleben nicht mit dieser physikalischen Ursache übereinstimmt, dann erklärst du das Erleben selbst für "problematisch" oder gar "nicht real". Und hier liegt dein Denkfehler: Das Erleben selbst (Zahnschmerzen) ist real, auch wenn es sich in der Ursache irrt. Wenn jemand Zahnschmerzen empfindet, fühlt er sie tatsächlich (und täuscht sich nicht etwa darüber), auch wenn die Ursache im Hirnstamm liegt. Das ist kein Widerspruch in der Realität, sondern eine Täuschung innerhalb eines realen Systems, ganz analog zu einer optischen Illusion: Ich kann zwei Linien als schräg zueinander sehen, obwohl sie parallel sind. Das Sehen täuscht mich zwar über die Realität, aber das "getäuscht werden" selbst ist ebenfalls real.
Gerne auch mit verständlichen Worten, dann gehe ich auch darauf ein.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Wie ich vermutet habe, du versuchst die Flucht ins "Erleben".
Das ist aber kein Ausweg, denn egal um welche Phänomenalexistenz es gehen soll, es ist die qualitativ belastete Zahnregion auf Basis von Existenz verankert.
Die nicht belastete Zahnregion ist aber genauso als Existenz verankert, und zwar im exakt gleichen Moment.
Damit ergibt sich innerhalb der Existenz(en) ein Widerspruch.
=> die Behauptung einer Phänomenalexistenz steht damit unter Unfugs-Verdacht.
Da ist es höchste Zeit, dass du mindestens die Fähigkeit zum Umgang mit dem Aktivitätsmuster vorlegst.
Wenn du nicht einmal das kannst, dann hast du weit mehr als nur Hausaufgaben, denn du versuchst das grundlegende Konzept der Realität auszuhebeln.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Du versuchst nun in einem zweiten Schritt, diesen Umstand irgendwie als einen "Widerspruch in der Realität" zu brandmarken, aber das ist ein Kategorienfehler: "Realität" setzt du mit einer physikalisch korrekten Lokalisation von Reizursachen gleich. Und wenn das Erleben nicht mit dieser physikalischen Ursache übereinstimmt, dann erklärst du das Erleben selbst für "problematisch" oder gar "nicht real". Und hier liegt dein Denkfehler: Das Erleben selbst (Zahnschmerzen) ist real, auch wenn es sich in der Ursache irrt. Wenn jemand Zahnschmerzen empfindet, fühlt er sie tatsächlich (und täuscht sich nicht etwa darüber), auch wenn die Ursache im Hirnstamm liegt. Das ist kein Widerspruch in der Realität, sondern eine Täuschung innerhalb eines realen Systems, ganz analog zu einer optischen Illusion: Ich kann zwei Linien als schräg zueinander sehen, obwohl sie parallel sind. Das Sehen täuscht mich zwar über die Realität, aber das "getäuscht werden" selbst ist ebenfalls real.
Du bist also nach wie vor unfähig, die Phänomenalqualität der genannten Überzeugung zu erklären. Darüber hinaus erklärst du das Erleben als bloße Reaktion, als eine "Überzeugung", die irgendwie zur Situation passt. Aber wenn das System sich "täuscht", weil es Zahnschmerz meldet, wo keiner ist, dann widersprichst du dir selbst: Entweder ist die Reaktion nicht mehr plausibel, oder du musst akzeptieren, dass Täuschung real erlebt wird, also Erleben real ist. Erneut degradierst du das Erleben zu einem bloßen "Verwaltungsakt" des Nervensystems, kannst aber nicht erklären, warum diese "Verwaltung" sich wie etwas anfühlt, warum sie nicht bloß ein Ablauf wie in einem Thermostat ist.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Das Problem hierbei ist nicht die Überzeugung, konkrete Zahnschmerzen zu empfinden, sondern deine Existenzerfindung.
Ich kann dich nur darauf hinweisen, dass die Realität nicht für "im Widerspruch stehende Existenzen" bekannt ist.
Du kreierst ein eigenartiges Realitätskonzept. Diesen Punkt hast du halt bisher übersehen - es ist halt nur Philosophie.
Wenn du keine Rückfragen beantwortest, geht in dieser Richtung rein gar nichts - dann wird es lediglich läppisch.
Starte mit der Fähigkeit ein neuronales Aktivitätsmuster trotz Verteilung (zeitlich, räumlich) als Grundlage für eine Phänomenalexistenz zu verwenden.
Wenn schon das nicht funktioniert, können wir uns deine restlichen Behauptungen sparen.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Dein funktionalistisch verkürzter Realitätsbegriff ist damit grundsätzlich zu eng. Wenn wir all das aus der Realität ausschließen wollten, was in sich widersprüchlich, irreführend oder kontextabhängig ist, müssten wir auch Erinnerungen, Halluzinationen, Träume und Vorstellungen aus der Realität entfernen, also wesentliche Teile des mentalen Lebens.
Es bleibt nichtsdestotrotz das Problem, den phänomenalen Gehalt solcher Überzeugungen zu erklären.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Niemand muss das Stattfinden der diesbezüglichen Überzeugungen ausschliessen.
Die Situation des Menschen wird sich durch eine Erklärung nicht verändern müssen.
Das ist aber noch lange kein Grund Phänomenalexistenzen auszurufen.
In deinen Antworten tust du so, als hättest du eine Berechtigung für das Behaupten von "Phänomenalexistenzen", weil du nach einer rudimentären Erwähnung des Nervensystems "aus der anderen Richtung" kommst und vom "subjektiven Erleben" her denkst.
Das "subjektive Erleben" aber kein "Raum von Existenz", sondern ein "Raum von Überzeugung".
Überzeugungen sind Reaktionen, die falsch und irreführend sein können, aber dennoch finden sie statt.
Das Reale daran ist nur das Stattfinden. In Überzeugungen können Zusammenhänge beachtet oder nicht beachtet werden, die damit falsch und irreführend beachtet sind.
Bei Existenzen ist das anders. Wenn du hier einen Widerspruch verankerst, dann kommt das Konzept von Realität ins Wanken.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Was du als "poetische Behauptung" abtust, ist also in Wirklichkeit die präziseste Beschreibung der erlebten Wirklichkeit, die wir haben.
Nein, mein Fundament basiert auf der Empirie subjektiver Erfahrungen, die sich nicht leugnen lassen. Qualia wie Schmerz sind real qua Erleben, auch wenn du das immer wieder abstreitest.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Dein Fundament besteht aus blumigen Behauptungen und das nennst du "die präziseste Beschreibung der erlebten Wirklichkeit".
Noch einmal: Das Anfühlen von Schmerz ist gerade keine Abstraktion, sondern das unmittelbare, subjektive Erleben, das der Abstraktion vorgelagert ist.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Ich für meinen Teil habe den Begriff "Schmerz" als abstrakt erkannt und ohne Aufsehen im nächsten Beitrag mehr Details angegeben, so dass der Begriff "Schmerz" präzisiert wurde.
Die Empfindung ist primär, der Begriff sekundär. Auch Tiere empfinden Schmerz – ganz ohne Worte, ganz ohne abstrahierende Begriffsbildung. Das Erleben kommt zuerst.
Und auch hier kann ich mich nur wiederholen:shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Weshalb kann ich dies durchführen, du aber nicht?
Weshalb habe ich ein Subjekt zur Verfügung, du aber nicht?
Wieso sehe ich, dass die Überzeugungen aus der menschlichen Wahrnehmung exakt zur Aufgabenstellung eines selbstlernenden körperlichen Akteurs passen, du aber nicht?
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Du versuchst offenbar, auf ein vages "Wer ist eigentlich das Ich?" ausweichen, um zu vermeiden, über den Elefanten im Raum zu sprechen: Dass Schmerz nicht einfach eine physikalisch verwaltete Belastung ist, sondern eine bewusst erlebte Qualität.
Wie gesagt: Nebelkerze. Es geht hier nicht darum, wer oder was genau das Subjekt ist, sondern wie sich phänomenales Erleben erklärt (Qualiaproblem). Wir können aber gerne mit der Ad-Hoc-Hypothese arbeiten, dass es sich beim Subjekt um ein informationsverarbeitendes System handelt, welches ein Modell von sich selbst in der Welt aufrechterhält.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Nein, nach den Details, die ich dir vorgelegt habe und meinen Hinweisen, dass damit eine körperliche Aufgabenstellung vorliegt, für die die Überzeugungen aus der menschlichen Wahrnehmung eine Lösung darstellen, ist es für meinen Ansatz klar, dass der Körper das Subjekt ist, das für sich selbst die konkret belastete Region als "sich in einer Belastungsform anfühlend" verwaltet.
Wir sind hier also vollständig auf Spur, wenn ich für deine Behauptungen nachfrage, wer rund um diese Phänomenalexistenzen als Subjekt auftauchen soll.
Wie man sehen kann, ist ausser einer poetischen Bemerkung nichts gekommen ("Wer das erlebt? Nun, die Frage nach dem Selbst ist zweifellos tief, aber...").
Es kann nicht an mir liegen, dass du nichts geschrieben hast, denn ich habe eindeutig nachgefragt.
shakazulu2 schrieb am 23.04.2025:"Farbe" ist abstrakt und steht für "das Sehen einer farbigen Oberfläche".
Jetzt können wir alles analog zu "Schmerz" durchspielen und am Ende wirst du wieder Probleme mit dem Begriff "Tatsache" bekommen, denn das qualitative Auftreten farbiger Oberflächen ist verortet, aber genau dort ist keine farbige Oberfläche.
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Auch ein Farbsensor "sieht eine farbige Oberfläche", aber er empfindet sie nicht als Rot. Und genau da beginnt das Problem der Qualia.
Das ist aber nicht der Punkt. Auch Photorezeptoren in frühen Organismen haben zunächst nur auf Licht reagiert und dahinter steckte ein rein physikalischer Vorgang: Licht trifft auf ein Molekül > chemische Reaktion > Signal. Mehrzellige Organismen entwickelten später komplexere Augen: Lichtsinneszellen wurden gebündelt, es kamen Linsen hinzu, die Auflösung wurde besser. Aber zu jedem Zeitpunkt bleibt es von außen betrachtet eine reine physikalisch-chemische Reizaufnahme und Verarbeitung. Nirgendwo auf diesem Kontinuum ergibt sich von allein das subjektive Erleben ("Wie fühlt es sich an, rot zu sehen?"), sondern es bleibt eben der berühmte "Explanatory Gap" und letztlich auch das, worauf David Chalmers mit dem "Hard Problem of Consciousness" hinweist: Physikalische Prozesse sind nur Zustandsänderungen. Qualia sind subjektive Erlebniszustände. Es gibt keine bekannte physikalische oder funktionale Brücke zwischen diesen beiden Ebenen.shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Naja, ein Farbsensor ist wie eine Sinneszelle. Das ist kein Sehen, sondern ein Aufnehmen von Einwirkung.
Wieder Nebelkerze. Deine "Fernwahrnehmung" erfolgt über das sog. stereoskopische Sehen (Stichwort 'Parallaxe'). Und ob wir über "Direktwahrnehmung" oder "Fernwahrnehmung" sprechen, spielt an dieser Stelle keine Rolle.shakazulu2 schrieb am 23.04.2025:Der Farbsensor führt sozusagen eine "Direktwahrnehmung" durch.
Der Körper führt aber eine "Fernwahrnehmung" durch - "Sehen" gilt als Fernwahrnehmung.
Die farbigen Oberflächen sind verortet, und zwar (in einem Abstand) gegenüber.
Ist nur der Impuls aus der Sinneszelle die Einwirkung aus einer Direktwahrnehmung, wie kommt man dann zur Fernwahrnehmung?
Noumenon schrieb am 23.04.2025:Denn warum führt eine solche Einbindung zu einem Erlebnis? Warum bleibt sie nicht einfach ein funktionales Muster, so wie auch in einem Roboter bestimmte Signale eingebunden und verarbeitet werden? Warum tut es dann dort nicht weh?
Auch ein selbstlernendes, selbstoptimierendes System kann vollkommen blind operieren, ohne irgendein subjektives Erleben. Die bloße Tatsache, dass ein System auf Situationen reagiert und seine Reaktionen optimiert, erklärt nicht, warum diese Reaktionen von innen her als "fühlend" und "erlebend" erscheinen. Sie erklärt nur, warum sie funktional besser werden. Du beschreibst also allenfalls die Entstehung und Entwicklung von Funktionalität, aber nicht die Entstehung von Phänomenalität. Außerdem verfügen auch technische Roboter und KI-Systeme heutzutage sehr wohl über funktionale Selbstmodelle (ein von Antonio Chella entwickelter Roboter bestand sogar den sog. "Spiegeltest"...). Trotzdem zeigen sie keinerlei Anzeichen von subjektivem Erleben. Ein Selbstmodell ist also offensichtlich keine hinreichende Erklärung für das Auftreten von phänomenalem Bewusstsein. Du kannst bspw. auch dem berühmten KI-Roboter "Sophia" einen roten Ball vor die Nase halten und bekommst als Antwort etwa "Ich sehe einen roten Ball.", aber die entscheidende Frage bleibt, ob und inwieweit das auch mit einem phänomenalen Erleben von Rot einhergeht bzw. was genau dafür notwendig wäre. Und einer Antwort auf diese Frage bleibst du nun einmal schuldig. Oder anders gefragt: Was genau an der 'Methodik' der Nervenzellen sollte logisch zwingend dazu führen, dass es sich nach innen hin irgendwie anfühlt? Wieso sollte aus funktionalem Reagieren subjektives Erleben hervorgehen?shakazulu2 schrieb am 24.04.2025:Die Gründe für die Überzeugung von "Erlebnis" liegen in der Aufgabenstellung "selbstlernender körperlicher Akteur in Umwelt" und der Lösungsmethodik "Finden der plausibelsten Reaktion".
Weil das Nervensystem für den Körper und seine Situation arbeitet, ergeben sich mit der speziellen Methodik der Nervenzellen, die Überzeugungen des Körpers: "subjektives Erleben".
Das Nervensystem bringt hier vielleicht gewisse wachstumsbasierte Optimierungen mit (Stichwort "Evolution"), aber das Grundprinzip bleibt, dass das Nervensystem die benötigten Funktionen (Reaktionen) in Bezug zur Aufgabenstellung erschliesst (deshalb auch das vorgeburtliche Trainingsprogramm).
Bei einem Roboter ist das anders.
Er entwickelt keine Reaktion zu seiner Situation (er verfügt auch bei weitem nicht über den Einblick in sich selbst, wie ein Mensch).
Er führt keine universelle Methode zur Reaktionsbestimmung durch.
Der Roboter startet in vorausgedacht fertiger Weise und sein Basisprinzip sind mathematische Zusammenhänge und Wenn/Dann-Abläufe.
Man muss es so sehen:
Das, was man bei einem Wahrnehmungssystem in den kleinsten Schritt hineinpackt, legt fest, was in der Gesamtheit herauskommt.
Wenn man also Abstraktionsschritte (sprich: fertige Minimalfunktionen) hineinpackt, dann kann die Kombination daraus nie mehr werden, als das.
Wenn man eine KI dadurch aufstellt, dass man mathematische Abläufe und mathematische Korrekturen in den Einzelschritt legt, dann ist auch die Gesamtheit eine mathematische Reaktion.
Es geht hier quasi um eine Art "Hochskalieren" - "was unten nicht drinsteckt, kann oben nicht herauskommen".
Das bedeutet: das Nervensystem führt bereits im kleinsten Einzelschritt (sagen wir jetzt mal "in einem Neuron") genau das durch, was das Gesamtlebewesen und auch die Überzeugungen des Lebewesens ausmacht.
Das Nervensystem findet eine bestimmte Art von Reaktion.
Aktuell schauen Forscher ins Nervensystem, erkennen die gröbsten Abläufe (versuchen dies sogar mathematisch festzuhalten - wie gerade geschrieben ergibt das "tierisch viel Sinn") und haben dennoch keine Ahnung, wie sich daraus Funktionalität ergeben können soll.
Aktuell ist also bei den Forschern unbekannt, nach welchem Prinzip das Nervensystem Funktionalität erreicht - die Methode des Roboters ist es auf jeden Fall nicht.
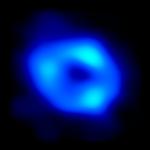
Ich muss zugeben, ich bin die letzten Beiträge eher im Schnelldurchlauf durchgegangen, da ihr doch auf einem sehr hohen Niveau unterwegs seid, wo ich nur schwer mithalten kann.Noumenon schrieb:Außerdem verfügen auch technische Roboter und KI-Systeme heutzutage sehr wohl über funktionale Selbstmodelle (ein von Antonio Chella entwickelter Roboter bestand sogar den sog. "Spiegeltest"...). Trotzdem zeigen sie keinerlei Anzeichen von subjektivem Erleben
Noumenon schrieb:Außerdem verfügen auch technische Roboter und KI-Systeme heutzutage sehr wohl über funktionale Selbstmodelle (ein von Antonio Chella entwickelter Roboter bestand sogar den sog. "Spiegeltest"...). Trotzdem zeigen sie keinerlei Anzeichen von subjektivem Erleben.
Natürlich lässt sich diese Frage nicht mit abschließender Gewissheit beantworten, denn die Unentscheidbarkeit der Frage nach dem maschinellen Erleben folgt ja gerade direkt aus dem hier diskutierten Qualiaproblem. Man könnte bspw. auch fragen "What is it like to be a robot?". Damit hätte man dann das maschinelle Analogon zu Thomas Nagels berühmter Frage "What is it like to be a bat?" und eine direkte Manifestation des Qualiaproblems in technologischem Gewand.SagittariusB schrieb:Woher nimmst du die Gewissheit, dass Künstliche Gehirne kein innenleben haben können.
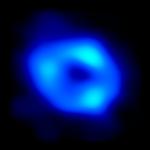
Wenn ich Chat GPT ein Foto von mir schicke und ihr sage lege mir einen Roten Umhang an und setze mir eine Goldene Krone auf, dann scheint das Programm sehr gut zu wissen was Farben bedeuten. Zumindest hat es die Voraussetzung dafür, ansonsten könnte es diese Unterscheidung von Rot und Goldgelb gar nicht treffen.Noumenon schrieb:Weder zeigen Maschinen phänomenale Selbstbeschreibungen (etwa dass sie eine Farbe als rot empfinden oder eine bestimmte Situation unangenehm erleben
Noumenon schrieb am 28.03.2025:SagittariusB schrieb am 04.09.2024:
Nach der EM ist Qualia lediglich die Illusion unserer Erfahrung, demnach sollte ausreichendes Wissen genügen um die Farbe der Banane korrekt zu identifizieren. Dennett vertritt genau diese Ansicht.
Eigentlich ein Perfektes Experiment für eine KI. Würde die dir am Ende die Banane gelb färben wenn du sie nur mit genug Informationen füttern würdest?Noumenon schrieb am 28.03.2025:Was natürlich Unfug ist. Ohne jemals die Farbe Gelb gesehen zu haben, kann man sie nicht als solche identifizieren.
Nein, nicht wenn es um ein System geht, das für den Ausschnitt seiner Sensorik im Aufbau der zugehörigen Überzeugungen eine Korrektheit erreicht und tatsächlich etwas abläuft, zu dem die Überzeugung "subjektives Erleben" passt (ACHTUNG: keine Gleichsetzung!).Noumenon schrieb:Auch ein selbstlernendes, selbstoptimierendes System kann vollkommen blind operieren, ohne irgendein subjektives Erleben.
Das ist zu einfach dargestellt und von uns beiden bist es genau du, der es so einfach darstellt.Noumenon schrieb:Die bloße Tatsache, dass ein System auf Situationen reagiert und seine Reaktionen optimiert, erklärt nicht, warum diese Reaktionen von innen her als "fühlend" und "erlebend" erscheinen.
Die Aufgabenstellung ist nirgendwo "Entstehung von Phänomenalität".Noumenon schrieb:Du beschreibst also allenfalls die Entstehung und Entwicklung von Funktionalität, aber nicht die Entstehung von Phänomenalität.
Nein, noch nicht einmal im Ansatz.Noumenon schrieb:Außerdem verfügen auch technische Roboter und KI-Systeme heutzutage sehr wohl über funktionale Selbstmodelle (ein von Antonio Chella entwickelter Roboter bestand sogar den sog. "Spiegeltest"...).
Nein, ich bleibe da gar nichts schuldig, sondern du biegst ständig auf Gleichsetzungsideen ab.Noumenon schrieb:aber die entscheidende Frage bleibt, ob und inwieweit das auch mit einem phänomenalen Erleben von Rot einhergeht bzw. was genau dafür notwendig wäre. Und einer Antwort auf diese Frage bleibst du nun einmal schuldig.
Mit dem, was ich gerade geschrieben habe, könntest du dein Problem, durch das du zu solchen Fragen kommst, verstehen.Noumenon schrieb:Was genau an der 'Methodik' der Nervenzellen sollte logisch zwingend dazu führen, dass es sich nach innen hin irgendwie anfühlt? Wieso sollte aus funktionalem Reagieren subjektives Erleben hervorgehen?
Nein, ohne das Grundkonzept, von den Einwirkungen ausgehend eine Reaktion zu einer möglichen Ursache dieser Einwirkung zu entwerfen, wird ein selbstlernender Akteur niemals "Fernwahrnehmung" durchführen.Noumenon schrieb:Deine "Fernwahrnehmung" erfolgt über das sog. stereoskopische Sehen (Stichwort 'Parallaxe'). Und ob wir über "Direktwahrnehmung" oder "Fernwahrnehmung" sprechen, spielt an dieser Stelle keine Rolle.
Nein, die Philosophen sind falsch abgebogen.Noumenon schrieb:Es bleibt eben der berühmte "Explanatory Gap" und letztlich auch das, worauf David Chalmers mit dem "Hard Problem of Consciousness" hinweist: Physikalische Prozesse sind nur Zustandsänderungen. Qualia sind subjektive Erlebniszustände. Es gibt keine bekannte physikalische oder funktionale Brücke zwischen diesen beiden Ebenen.
Mit dieser Haltung bist du genau dort, wo die Philosophen mit "Zustand" sind.Noumenon schrieb:Es geht hier nicht darum, wer oder was genau das Subjekt ist, sondern wie sich phänomenales Erleben erklärt (Qualiaproblem).
Nein, der eigentliche Umstand ist, dass der "Wahrnehmung entwickelnde Körper" "sich fühlt" (in seinen Überzeugungen).Noumenon schrieb:Noch einmal: Das Anfühlen von Schmerz ist gerade keine Abstraktion, sondern das unmittelbare, subjektive Erleben, das der Abstraktion vorgelagert ist.
Doch, eigentlich schon, denn der Rahmen ist sehr eng.Noumenon schrieb:Natürlich lässt sich diese Frage nicht mit abschließender Gewissheit beantworten, denn die Unentscheidbarkeit der Frage nach dem maschinellen Erleben folgt ja gerade direkt aus dem hier diskutierten Qualiaproblem.