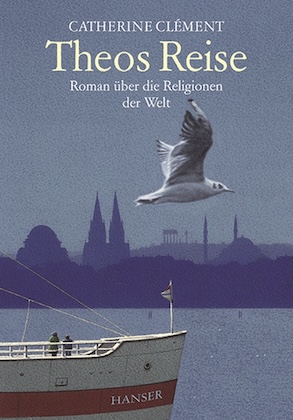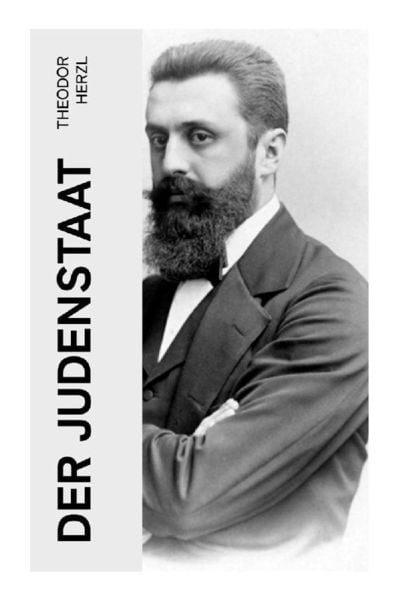joleen

Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

beschäftigt
dabei seit 2014
dabei seit 2014
Profil anzeigen
Private Nachricht
Link kopieren
Lesezeichen setzen

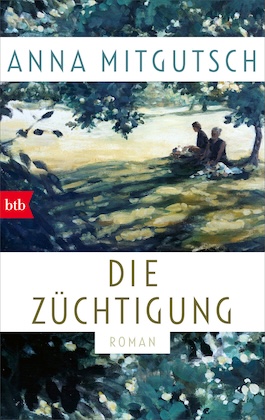
Nach der Kirche musste ich mich nackt ausziehen und wurde mit dem Teppichklopfer geschlagen, bis ich bewegungslos und lautlos auf dem Boden lag, und mein Vater sagte, da siehst du, was du mit deiner Brutalität ausrichtest, erschlagen tust du das Kind noch. Aber als ich geschrien hatte, Papa, Papa, hilf, war er auf dem Sofa gesessen und hatte nicht gewagt, in die Züchtigung einzugreifen.Veras Leistungen in der Schule sind unterschiedlich. In der Volksschule Klassenbeste, sie geht gegen den Willen der Eltern auf das Gymnasium, obwohl sie sich damit abfinden und sogar eine Privatschule sich leisten. Das ist die andere Seite der Eltern: Sie bringen finanzielle Opfer, um der Tochter (sie ist ein Einzelkind) eine Zukunftschance bieten zu können. Die Mutter hofft, dass Vera ihren eigenen Berufstraum wahr werden lässt: Klosterlehrerin. Erst am Ende der Gymnasialzeit fängt Vera sich wieder und legt die Reifeprüfung mit Vorzug ab. Das durch die häusliche Gewalt begründete psychische Auf und Ab zeigt sich auch körperlich. Bis zur Pubertät isst Vera Unmengen und wird immer dicker, ab der Pubertät verweigert sie Essen, bricht es und wird hager. Abgemagert.
Schlagen war ein Ritual, von Ritualen umgeben.
Später verliebte ich mich in Künstler, feminine Männer, Träumer, denen irgendwann die Träume zerfallen waren und die mich in ihre Träume hineinziehen wollten, sich von mir ihre Träume bestätigen und realisieren lassen wollten, während ich sie durchschaute, verachtete und enttäuscht weglegte.Vera ist alleinerziehende Mutter einer Tochter und will die Tradition gewalttätiger Erziehung defintiv nicht fortsetzen, was ihr postwendend wegen der Verhaltensauffälligkeit ihres Kindes Tadel eines Psychologen einbringt:
Das eine vor allem wollte ich von Anfang an, das Kind vor dieser Erbschaft der Selbstzerstörung bewahren. Den Zwang wollte ich fernhalten, die Angst vor der Strafe, die Demütigung, der Schwächere zu sein, und die Unfähigkeit, sich dagegen aufzulehnen. Sie ersticken das Kind mit Liebe, sagte der Psychologe, Sie können nicht loslassen, Sie hemmen seine Entwicklung. Das ist nicht wahr, wollte ich rufen, aber ich schwieg und nahm alle Schuld auf mich, ich hatte wieder einmal versagt.Die Mutter stirbt relativ jung. Sie hat über Jahre hinweg an Kopfschmerzen gelitten, und das eher scherzhaft gemeinte Bonmot ihres Mannes, dass da wohl ein Tumor in ihrem Hirn sitze, welcher der Grund für ihr Verhalten sei, stellt sich als korrekte Diagnose heraus. Nur ging Marie selten zum Arzt und dieser hat auch keine Ahnung, wie er diagnostizieren sollte. Es sei wohl psychisch. Als Marie verfällt, im Krankenhaus künstlich ernährt wird, Morphium gegen ihre Schmerzen erhält und schließlich stirbt, wird im Krankenhaus die wahre Diagnose gegeben: Ihr gesamter Körper war bereits von Metastasen zerfressen.
Ich trat ihr Erbe an, in den Trauerkleidern, die sie vom Spitalsbett aus für mich bestimmt hatte, mit der Frisur, die sie für richtig befunden hatte, kein Haar hing aus der Frisur. Ich wurde fromm, streng, unnahbar, misstrauisch und ehrgeizig. Ich glänzte in den Seminaren und biss vor Einsamkeit schreiend in die Polster. Mein Vater heiratete übers Jahr und wurde glücklich. Er konnte sich endlich erlauben, seinen Hass auszusprechen, seine zwanzigjährige Demütigung abzugrenzen, sie war ein Abschnitt seiner Vergangenheit geworden. Ich liebte sie und wollte werden wie sie, bis ich ihr Gegenteil wurde und sie hasste.Einblick bekommen wir auch in die Schwestern von Veras Mutter Marie. Rosi heiratet einen Lehrer, der Gedichte schreibt, sie jedoch permanent grün und blau schlägt und sich dabei befriedigt. Sie lässt sich scheiden. Ein Familienskandal. Die Scheidung, nicht die sadistische Perversion ihres Mannes. Angela wird Bäuerin und hat neben ihrer schweren Arbeit sechs Geburten in acht Jahren. Ihr Mann schlägt sie. Heidi heiratet ebenso wie Marie einen Häuslersohn (sogar einen unehelich geborenen). Dieser geht zur Zollwache an der tschechoslowakischen Grenze und sie können sich einen gewissen kleinbürgerlichen Wohlstand leisten. Auch ist er nicht gewalttätig, das Kind ist ein Wunschkind und sie können sich ein Motorrad leisten.
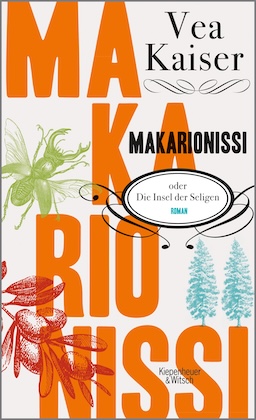
achtzigtausend Quadratmeter, zweihundertsiebenundachtzig Zimmer, drei Restaurants, ein großer Süßwasserpool, zwei Kinderbecken, Haupthaus, einige Bungalows und Vierundzwanzigstunden-Roomservice wie in amerikanischen Nobelressorts ... Die Balkone, die das Hotel sowohl zum Meer als auch zum Binnenland hin umgaben, waren in leuchtendem Weiß gestrichen. Die Oleanderhecken, Palmen, Bananenstauden, die die Einfahrt säumten und die große Sonnenterrasse von der Inselseite abschirmten, mussten zwar noch wachsen, doch ihr sattes Grün ließ schon jetzt erahnen, was Milton mit dem »paradiesischen Garten« meinte, den er zwischen den Swimmingpools und der mit Marmor gepflasterten Promenade hinunter zum Strand anlegen wollte.Nachdem ihr Mann Milton im Schlaf gestorben ist, führt Eleni das Hotel allein weiter. Die ortsansässigen Arbeitskräfte sind längst durch solche aus Albanien ersetzt worden. Angeblich, weil alle sich im Tourismusbereich, den das Hotel angekurbelt hat, selbständig gemacht hätten. Dass vielleicht ihre Löhne niedriger sein konnten, davon schreibt Kaiser nichts. Auch hält sie Yogakurse für die Hotelgäste. Elenis Tochter Aspasia wird als Teen von einem Ingenieur schwanger und gebiert Zwillinge. Zwei Söhne. Sie werden alleine aufgezogen.
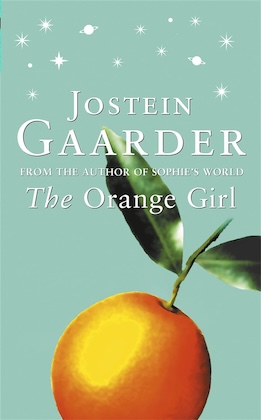
‘... you’re bloody daft!’ I shouted. ‘You had two boyfriends at once!’Und gleich weiter ist sie für ihn ein "altes Huhn".
I almost felt a bit sorry for the old chick now. She was still pale. Despite myself I said: ‘Could I ask which of the two the Orange Girl was fondest of?’Dieses impertinente Verhalten passt eigentlich nicht zu dem eher gesetzten, nicht emotional hochbrausenden Stil des Textes.
‘No,’ she said emphatically, ‘you can’t ask.’
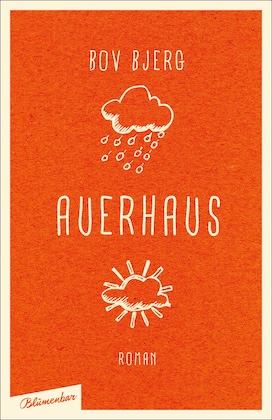
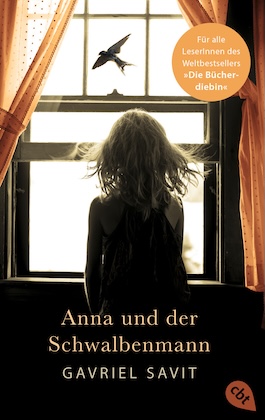
Menschen sind die größte Hoffnung des Menschen, zu überleben.Eine zentrale Rolle in diesem Text spielt Sprache. Anna wie der Schwalbenmann sprechen viele Sprachen, Anna wegen ihres Vaters und seiner Freunde, mit denen sie immer in unterschiedlichen Sprachen konversiert hat:
Mit ihren knapp sieben Jahren sprach Anna fließend Deutsch, Russisch, Französisch und Englisch, konnte sich auf Jiddisch und Ukrainisch verständigen und besaß Grundkenntnisse in Armenisch und dem karpatischen Romani. Ihr Vater sprach niemals Polnisch mit ihr. Polnisch, die Landessprache, erklärte er, käme von selbst.Wie realistisch dies ist, kann ich nicht beurteilen.
Gewöhnlich reichte dem Schwalbenmann diese Aufforderung – ein Wort oder zwei –, um den Dialekt des Sprechers zu erkennen, doch er war so gewieft, dass er zunächst einen Moment vor sich hin murmelte, während er in seinem Arztkoffer herumkramte. »Ah«, sagte er dann in Sprache und Dialekt des Soldaten. »Natürlich. Papiere, Papiere, Papiere …«Ein zweites Kernthema ist Natur. Nicht nur dass der Schwalbenmann mit Vögeln kommunizieren kann, er gibt auch vor, auf seiner Wanderung ein Exemplar einer aussterbenden Vogelart zu suchen (welche, wird nicht genannt). An einer Stelle wird konstatiert, dass sie nicht nur von Betteln und Diebstahl lebten, sondern auch von den Früchten Polens. Der Schwalbenmann kennt die essbaren Beeren und Kräuter. An den masurischen Seen angeln sie. Hart wird es im Winter, als sie viele Hungertage durchmachen müssen.
Es kam auf das perfekte Timing bei der Übergabe des Dokuments an. Der Schwalbenmann musste die Frage stellen, bevor er dem Soldaten den Pass reichte, damit der Soldat antwortete, bevor er ihn öffnen konnte, doch er durfte dabei auf keinen Fall anbiedernd wirken.
»Woher kommen Sie?« Die Frage musste zurückhaltend klingen, fast unfreiwillig, als wäre es eine kleine Zumutung für ihn, überhaupt zu fragen.
Ganz gleich welcher Orts- oder Gebietsname dem Soldaten nun über die Lippen kam, stets riss der Schwalbenmann perplex die Augen auf und lachte durch und durch ehrlich überrascht. Eine Reaktion, wie sie nur von einem Landsmann stammen konnte: die verblüffte Freude, den Namen des geliebten Orts zu hören, wenn man so weit fort von daheim war.
Erst konnte Anna kaum glauben, wie täuschend echt der Betrug wirkte. Immerhin sah sie den Schwalbenmann, wenn nicht jedes Mal exakt gleich, so doch nicht weniger beglückt reagieren bei Namen, die so exotisch und fremd klangen wie Lindau, Saraisk, Machatschkala, Quedlinburg, Gräfenhainichen, Mglin und Suhl – Ortsnamen, die für Anna genauso gut Sterne an den entferntesten Ausläufern des Himmels bezeichnen konnten. Doch bald begriff sie, dass es gar keine Täuschung war.
Lügen stellen den Versuch dar, über die existierende Welt die hauchdünne Schicht einer Ersatzwelt zu stülpen, um sie den eigenen Absichten anzupassen. Der Schwalbenmann aber musste sich die Welt nicht anpassen. Er passte sich der Welt an. Das war es, was es hieß, die Sprache der Straße zu beherrschen.
Der Schlüssel ihres Erfolgs beim Grenzübergang war, dass der Schwalbenmann nie direkt sagte, er käme aus dem Ort, den der Soldat nannte. Die Menschen (auch verkleidete Raubtiere) waren sich ihrer Meinung sicherer, wenn sie sich einbildeten, sie hätten sie aus freien Stücken gefasst. Statt ihnen eine simple Lüge aufzutischen, erging sich der Schwalbenmann in einer Reihe von Fragen und Lobgesängen.
»Warum braut hier keiner Bier wie zu Hause?«, sagte er. »Was würde ich für ein gutes Helles geben.« Selbst wenn ausgerechnet dieser Soldat kein Biertrinker wäre (und welcher junge Mann war das nicht?), würde er niemals zurückweisen, dass ein Produkt seiner Heimat das Beste sei. Oder er sagte: »Wie ist das Leben auf dem Lenin-Prospekt?« Inzwischen gab es in jeder Stadt der Sowjetunion eine Straße, die nach Lenin benannt war. Oder er rief: »Unser Weihnachtsmarkt! Ich hatte solches Heimweh. Es ist doch die schönste Zeit im Jahr.« In welcher deutschen Stadt gab es keinen romantischen Weihnachtsmarkt? Und welcher junge Mann hatte kein Heimweh, wenn die Feiertage nahten und er durch irgendein gottverlassenes polnisches Feld stapfen musste?

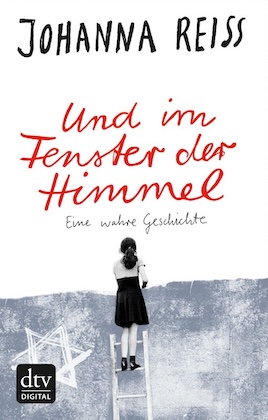
Es war sehr spät und sehr finster, als Herr Hannink wieder zu uns kam. Er müsse Johan etwas Wichtiges fragen, sagte er, etwas, was mit dem Bauern und den zehn Juden zu tun hatte, die sie erwischt hatten.Auch die Schilderung, dass gegen Ende der Besatzung die deutschen Soldaten immer brutaler mit der niederländischen Bevölkerung umgegangen ist, geht an die Grenze des Erträglichen.
»Setzen Sie sich«, sagte Johan ernst.
»Jemand hat den Deutschen einen Tipp gegeben«, sagte Herr Hannink. »Die wussten, dass die ganzen Juden da waren, und kannten ihr Versteck.« Er senkte die Stimme noch weiter. »Und ich weiß, wer dieser Jemand ist.«
Wir beobachteten seinen Mund. Was würde er als Nächstes sagen?
Er räusperte sich. »Dieser Mann muss weg, bevor er noch mehr Unheil anrichtet.« Seine Augen blieben an Johan hängen. »Traust du dir das zu?«
Dientje ging hinüber zu Johan. Drohend baute sie sich vor ihm auf.
»Nun ja«, sagte Johan zögerlich, »um ehrlich zu sein, Herr Hannink, eigentlich hab ich noch nie jemanden umgebracht.«
»Gottogottogott«, sagte Opoe.
Schwierig wäre es nicht, erklärte Herr Hannink. »Ich geb dir einen Revolver. Du kannst dich im Graben neben seinem Haus verstecken und warten, bis er rauskommt. Sobald du ihn erschossen hast, verschwindest du.«
Langsam schüttelte Johan den Kopf. »Wenn mir irgendwas zustößt, dann drehen die Frauen hier durch«, sagte er.
Dientje ging zurück zu ihrem Stuhl.
Ein paar Tage darauf kam ein Junge vorbei. Er wolle mit Oosterveld über einen Auftrag reden, der erledigt werden müsse, sagte er. Er zeigte Johan einen Zettel, den Herr Hannink unterschrieben hatte.
Er blieb noch eine Weile und zog dann mit dem Revolver und den Anweisungen ab, die Herr Hannink Johan erteilt hatte.
Es dauerte nur einen Tag. Die Deutschen waren sehr wütend. Warum war so ein guter Mann nur totgeschossen worden? Um zu zeigen, wie wütend sie waren, verhafteten sie eine Anzahl Leute. Die lassen wir frei, sobald sich der Mörder unseres Freundes stellt, sagten sie.
Als er das nicht tat, wurden die Geiseln auf der Hauptstraße von Usselo gefunden, erschossen. Man hatte ihnen die Finger gebrochen.
Da wurden wir sehr still, vor allem Johan.
Die Soldaten wurden gemeiner und gemeiner, und die Angst war größer denn je, bei allen, vor allem und jedem.Streckenweise ist es ein sehr beklemmendes Buch, auch wenn die Familie es schafft zu überleben.
An einem Abend waren Soldaten in Amsterdam in die Kinos marschiert. Sie hatten das Licht angedreht, um zu sehen, welche Männer jung genug waren, um nach Deutschland zu gehen. Es gab immer noch so viel Arbeit zu tun für Deutschland, und nicht genug Deutsche dafür. Auch nicht genug Juden. Aber holländische Nichtjuden, die gab es noch. Nach diesem Abend ging kein Mann mehr ins Kino, aber das nützte auch nichts. Die Soldaten suchten auch anderswo: in Kirchen, in Zügen. Wenn sie sich aufregten, weil sie nicht genug Männer zum Mitnehmen fanden, dann schossen sie auf die Passanten auf der Straße.
Ladies and Gentlemen, das ist ein Überfall! Die Geschichte von Bonnie & Clyde
Michaela Karl
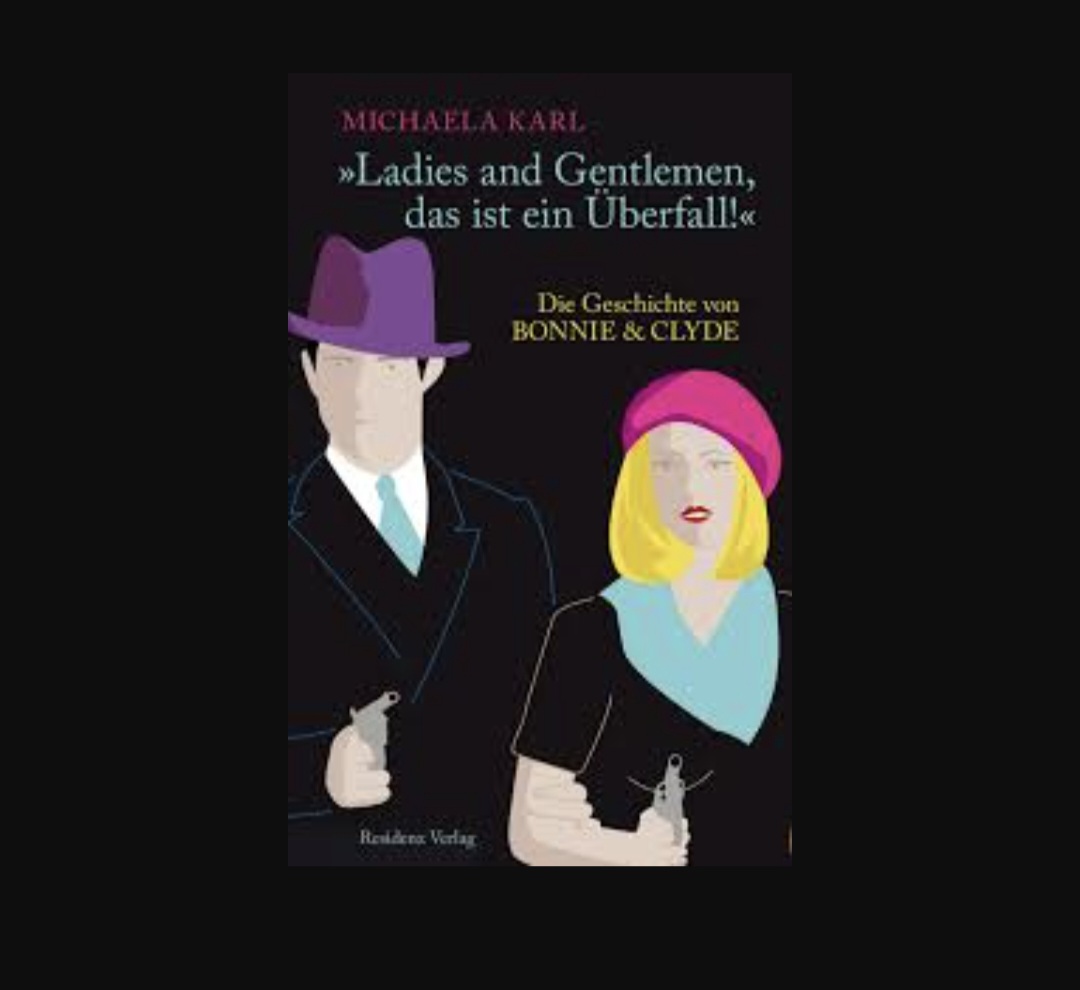
Amerika in den 1930er-Jahren, die Zeit der Großen Depression. Um Armut und Arbeitslosigkeit zu entfliehen, entwickeln Bonnie & Clyde ein eigenwilliges Geschäftsmodell: sie rauben Banken aus. Bewundert von den Verlierern des amerikanischen Traums, halten sie das Land zwei Jahre lang in Atem. Doch dann erklärt FBI-Direktor Hoover den beiden Verbrechern den Krieg …Sehr spannend & informativ 👌
Wie konnten zwei junge Menschen aus Texas, auf deren Konto kaltblütige Morde gingen, zu Volkshelden werden?
Michaela Karl erzählt in ihrem neuen Buch die spannende Geschichte von Bonnie & Clyde: Es ist die Geschichte von einem kompromisslosen Kampf gegen Staat und Gesetz – und von der großen Liebe.
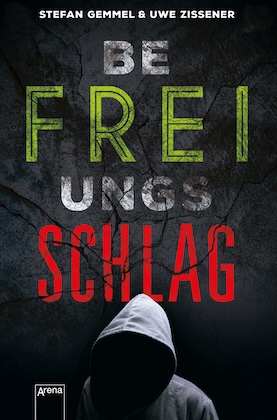
"Wir alle sitzen im Knast, weil wir nie über unsere Probleme gesprochen haben. Das ist das Verbrechen, das wir uns selbst gegenüber begangen haben. Alle anderen Taten resultieren einzig und allein daraus: Wir haben nie über unsere Gefühle gesprochen. Wie also hätte jemand wissen können, dass wir Hilfe brauchen? Wie soll uns jemand verstehen können, wenn wir das, was uns beschäftigt und so arg zusetzt, niemandem erzählen? All unsere ›Befreiungsschläge‹, all unsere Taten, um uns zu beweisen und uns durchzusetzen, waren ›Luftschüsse‹. Alles das wäre nicht nötig gewesen, wenn uns eines gelungen wäre: über unsere Gefühle zu sprechen."Der Schluss wirkt dann schon übertrieben kitschig. Maik hat den Brief an Bjarne abgeschickt und klingelt schließlich an dessen Haustüre. Bjarne, den Maik fast tot geschlagen hat, ist erfreut über den Brief gewesen und bittet Maik ins Haus. Dies ist der Befreiungsschlag.
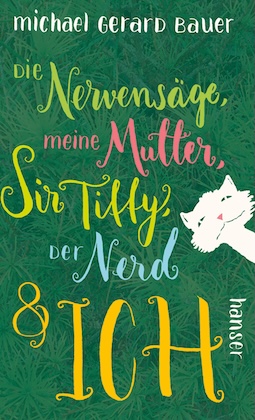
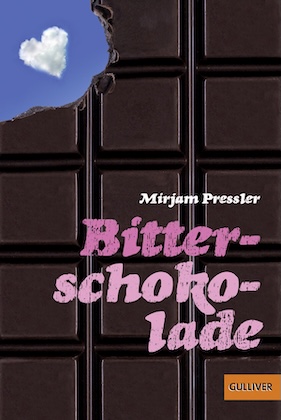
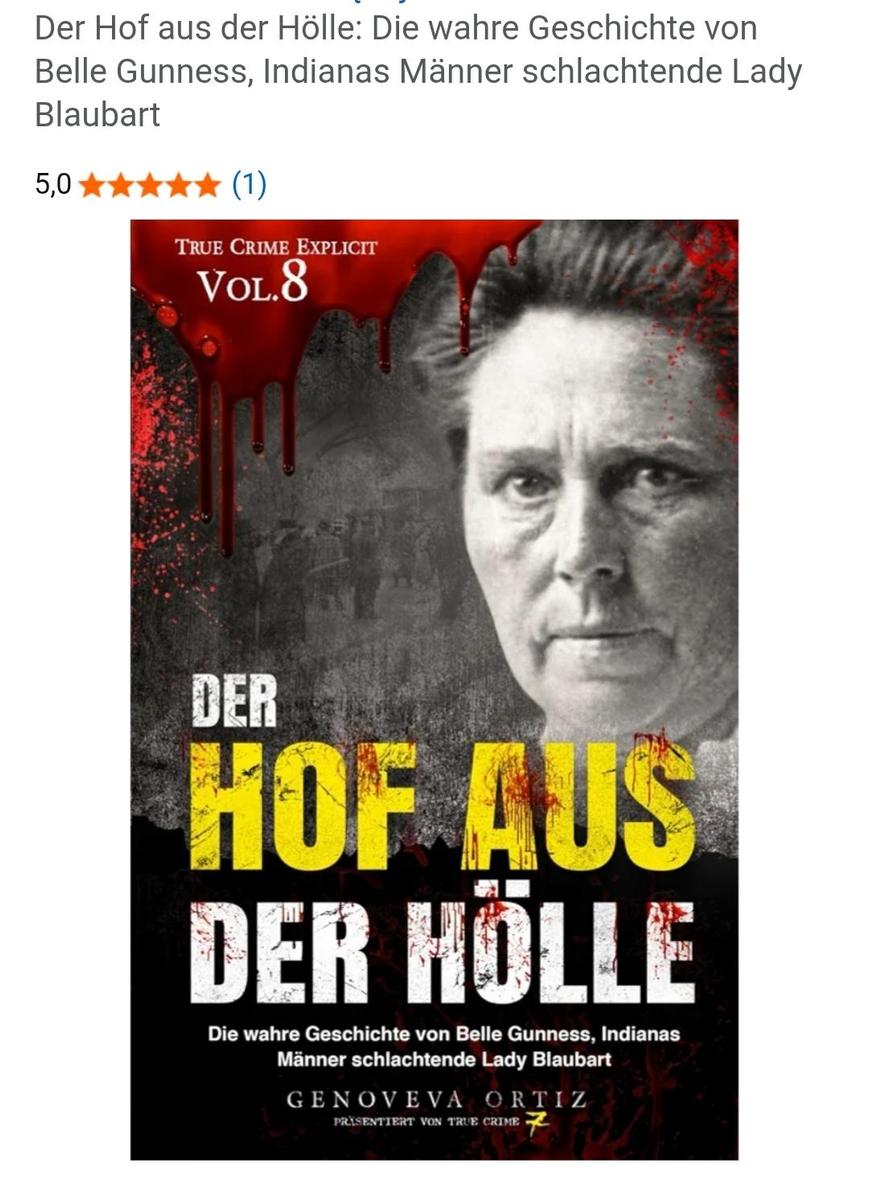 Original anzeigen (0,6 MB)
Original anzeigen (0,6 MB)