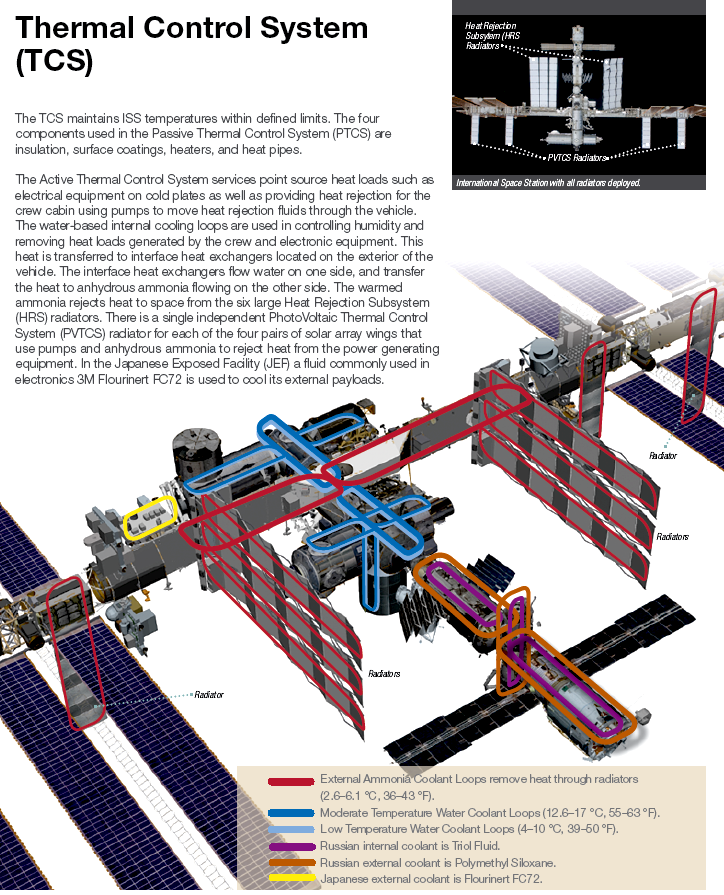geeky schrieb am 28.06.2025:TomBooth schrieb:
geeky schrieb am 28.06.2025:TomBooth schrieb:Das war also meine Vorhersage: Wenn ich den Motor so isolieren würde, dass die Wärme nur auf der heißen Seite eindringen kann, würde der Motor kühler laufen, weil er die Wärme intern in Arbeit umwandelt.
Auf welcher Theorie beruht diese Vorhersage?
Es tut mir leid, wenn ich manchmal nicht dazu komme, eine Frage zu beantworten, und es dann manchmal vergesse, da immer mehr Fragen auftauchen.
Ich glaube, ich habe die Theorie dahinter bereits erklärt und beschrieben, wie und wann mir die Idee zum ersten Mal in den Sinn kam.
Ich habe vor langer Zeit viele Bücher und Artikel zu verschiedenen Themen rund um Stirlingmotoren gelesen. Ich habe bereits einen Link zum Stirlingmotor-Forum und meinen ersten Beitrag dort für die anderen Mitglieder des Forums gepostet.
Alles kann hier im Kontext nachgelesen werden:
https://stirlingengineforum.boydhouse.com/viewtopic.php?t=478&sid=fe5104d93f3ebff9ef31778ced761552Es scheint, dass Sie meine zuvor gepostete Übersetzung bereits gelesen haben, da Sie daraus zitieren.
@zaeld Scheint, die Übersetzung meines Beitrags auch gelesen und verstanden zu haben. Wärme in einer Stirling-Wärmekraftmaschine wird in Arbeit umgewandelt. Dadurch wird die Temperatur des Gases gekühlt oder gesenkt, ohne dass Wärme vom Motor zur Senke geleitet wird. Anstatt aus dem Motor zu einer externen Senke geleitet zu werden, wird die Wärme intern in „Arbeit“ umgewandelt, indem sie sich ausdehnt und den Kolben antreibt.
Für mich war das damals eine umwerfende Offenbarung.
Die sogenannte „Carnot“-Grenze (fälschlicherweise zugeschrieben) besagt, dass nur ein Bruchteil der in jedem Zyklus in den Motor übertragenen Wärme in Arbeit umgewandelt werden kann und der Rest unbedingt an die Wärmesenke weitergeleitet werden muss.
Als ich das hier las, wusste ich nichts von einer solchen Einschränkung. Als mir dann aber klar wurde, was hier behauptet wurde, nämlich dass die Arbeitsleistung des Stirlingmotors für den Temperaturabfall verantwortlich sei, der die Kontraktion des Gases und die Rückkehr des Kolbens ermöglichte, stellte ich mir vor, dass dies in einem solchen Ausmaß geschehen könnte, dass das Arbeitsfluid im Motor tatsächlich kälter wird als die Außenluft.
Keine meiner Quellen erwähnte eine „Carnot-Grenze“. Es handelte sich meist um alte Lehrbücher, die offenbar vor der Erfindung dieser falschen Bezeichnung verfasst worden waren.
Wie dem auch sei, meine Fantasie ging mit mir durch und ich dachte mir, dass ein Stirlingmotor, der so konstruiert ist, dass er ein Maximum an „Arbeit“ leistet, wie eine Art Kühlschrank funktionieren könnte, der sich intern kühl hält, sodass keine Wärmeableitung an einen „Kältespeicher“ nötig wäre.
Diese Methode, die Temperatur eines Gases zu senken, indem es beim Ausdehnen in einem Motor Arbeit verrichtet und einen Kolben antreibt, ist keine spekulative oder fantastische Erfindung meiner eigenen Fantasie. Ich habe sie in alten Thermodynamik- und Physiklehrbüchern und anderen Nachschlagewerken über die Geschichte der Gasverflüssigung gelesen. Es handelt sich um ein industrielles Verfahren, das auch heute noch angewendet wird.
Um Gas mit dieser Methode zu verflüssigen, indem es in einem Motor Arbeit verrichtet, wird natürlich hoher Druck verwendet. Dieser ist deutlich höher als der, der normalerweise in einem Stirlingmotor erzeugt wird, und wird benötigt, um das Gas zur Verflüssigung auf kryogene Temperaturen zu bringen. Könnte derselbe Prozess in einem Stirlingmotor nicht zu einer geringeren Abkühlung führen? Vielleicht nur wenige Grad unter der Umgebungstemperatur?
Meine einzige Theorie war, dass das, was ich in den Lehrbüchern las, auf Stirlingmotoren anwendbar sein könnte. Ich habe einfach gelesen und versucht, eins und eins zusammenzuzählen. Arbeit im Motor senkt die Temperatur des Arbeitsmediums. Eine anerkannte wissenschaftliche Tatsache. Gar keine abwegige Idee.
Die Behauptung, ein Temperaturverhältnis setze dem Prozess auf mysteriöse Weise eine strikte Grenze, sodass nur ein kleiner Teil der in den Motor übertragenen Wärme umgewandelt werden könne, halte ich für eine „außergewöhnliche Behauptung“, die zumindest einer empirischen Überprüfung bedarf. Historisch gesehen gibt es jedoch keinerlei experimentelle Beweise, die die Carnot-Behauptung zur Wirkungsgradgrenze stützen.