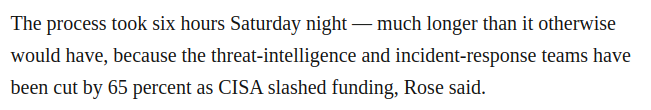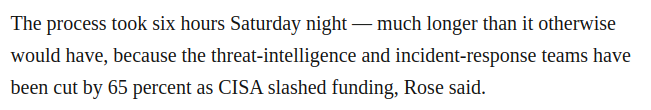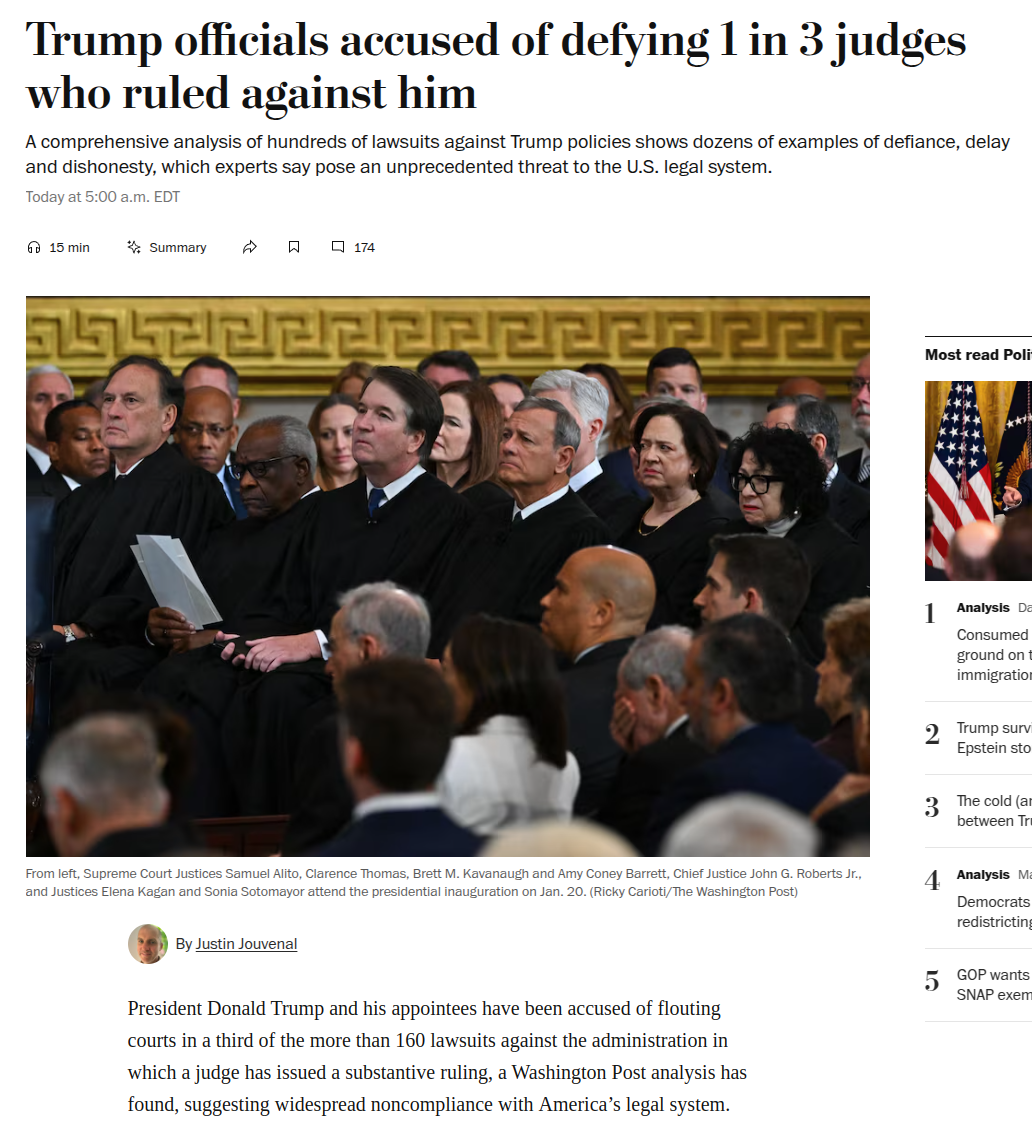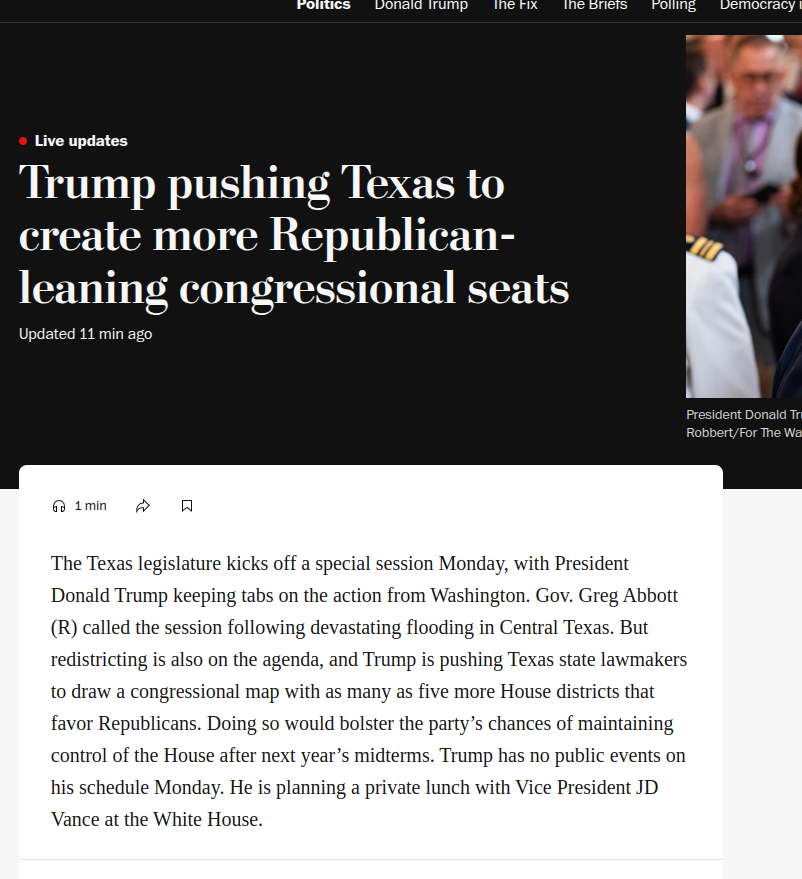juvenilea schrieb:Sollten wir uns ein Beispiel nehmen.
juvenilea schrieb:Sollten wir uns ein Beispiel nehmen.
Deutschland hat von ursprünglich mal geschätzten 1.100 sog. Ortskräften inzwischen über 20.000 aufgenommen, nachdem die Definition, was eine Ortskraft ist, mehrfach ausgeweitet wurde, zunächst auf weitere Personen die mittelbar für Deutschland bzw. deutsche Institutionen tätig waren, dann auf deren Angehörige usw. - Dass man da irgendwann mal sagt "Ist gut jetzt" ist irgendwo nachvollziehbar, des geht da weniger darum dass jemand "selbst Schuld" ist der für uns arbeitet, sondern darum ob dessen Großcousin deswegen auch noch hergeholt werden muss...
Auf Abgeordnetenwacht wird das erläutert:
Vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an der Thematik rund um die Evakuierung afghanischer Ortskräfte. Die Diskrepanz der Zahlen, die Sie ansprechen, wirft berechtigte Fragen auf und verdient eine transparente Erklärung.
Die unterschiedlichen Zahlen resultieren aus mehreren Faktoren, die sich im Verlauf der Evakuierungsmaßnahmen und der politischen Entwicklungen in Afghanistan zwischen 2021 und heute ergeben haben. Ich möchte Ihnen diese Hintergründe detailliert erläutern:
1. Definition und Anerkennung von Ortskräften
Im ursprünglichen Kontext wurden unter dem Begriff "Ortskräfte" primär jene Personen verstanden, die direkt bei der Bundeswehr oder deutschen Behörden in Afghanistan angestellt waren – beispielsweise Dolmetscher, Fahrer oder technische Hilfskräfte. Diese Gruppe war vergleichsweise klein und wurde in der ursprünglichen Statistik erfasst (die von ca. 1.100 betroffenen Personen inklusive Familienangehörigen ausging).
Nach dem abrupten Machtwechsel in Afghanistan im August 2021 wurde der Kreis der Schutzberechtigten jedoch erheblich ausgeweitet. Dazu zählten nun auch:
Ehemalige Ortskräfte, die ihren Dienst bereits Jahre zuvor beendet hatten.
Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Projekten, die deutsche Ministerien finanzierten.
Aktivisten, Journalisten und Personen, die aufgrund ihres Engagements für demokratische Werte gefährdet waren.
Diese erweiterte Definition führte zu einer deutlich höheren Anzahl von Schutzsuchenden, die letztlich als "Ortskräfte und deren Familien" betrachtet wurden.
2. Familiennachzug und größere Haushaltsgrößen
In Afghanistan sind Familienstrukturen oft deutlich größer als in Deutschland. Während in den frühen Planungen oft von durchschnittlich drei bis fünf Personen pro Familie ausgegangen wurde, zeigte sich in der Praxis, dass viele betroffene Ortskräfte mit deutlich größeren Haushalten lebten.
So kam es dazu, dass aus ursprünglich einigen Hundert Ortskräften letztlich Tausende betroffene Personen wurden, da auch Ehepartner, Kinder und teilweise weitere enge Verwandte als schutzbedürftig galten.
3. Mangelnde Dokumentation und unsichere Lage vor Ort
Die chaotischen Zustände während des Fall Kabuls erschwerten zudem eine exakte Dokumentation. Viele Personen, die sich vor den Taliban verstecken mussten, hatten keine vollständigen Nachweise über ihre frühere Tätigkeit bei der Bundeswehr oder deutschen Institutionen. Aus humanitären Gründen wurde in vielen Fällen dennoch Hilfe gewährt – insbesondere dann, wenn Gefährdungslagen glaubhaft dargelegt wurden.
4. Politische Entscheidungen und Druck auf die Bundesregierung
Nach dem dramatischen Fall von Kabul wuchs der innenpolitische und internationale Druck auf die Bundesregierung, möglichst viele gefährdete Personen zu evakuieren. Infolgedessen wurde das Aufnahmeverfahren angepasst und in vielen Fällen großzügiger gehandhabt.
5. Unterstützung durch Partnerorganisationen
Ein weiterer Faktor ist die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und ehrenamtlichen Initiativen, die auf eigene Faust afghanische Ortskräfte und deren Familien identifiziert und ihre Evakuierung unterstützt haben. Auch hier wurden zahlreiche gefährdete Personen nachträglich als schutzbedürftig anerkannt.
Fazit
Die deutliche Diskrepanz der Zahlen zwischen 2021 und heute ist das Ergebnis eines erweiterten Begriffs der "Ortskräfte", einer humanitär motivierten Praxis während der Evakuierungsphase und einer realistischen Anpassung an die Lebensrealitäten afghanischer Familien.
Ich kann gut nachvollziehen, dass diese Entwicklung auf den ersten Blick verwirrend erscheint – gerade wenn man sich an den ursprünglich bekannten Zahlen orientiert. Doch angesichts der dramatischen Lage vor Ort und der Verantwortung Deutschlands gegenüber jenen, die unsere Bundeswehr und deutsche Institutionen vor Ort unterstützt haben, halte ich das Vorgehen für nachvollziehbar.
Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema haben, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Simone Borchardt, MdB
https://www.abgeordnetenwatch.de/profile/simone-borchardt/fragen-antworten/wie-kommt-es-zu-dieser-eklatanen-abweichung-der-anzahl-der-ortskraefte-in-afghanistan-zwischen-dem-jahrMit anderen Worten: bereits in der ersten Ausweitung der Definition wurden Personen mit einbezogen, die nie im engeren Sinn für Deutschland gearbeitet haben, später wurde dann auch auf Dokumentation oder Nachweise verzichtet, bzw. den Behauptungen von nicht näher benannten NGOs und Initiativen gefolgt, die dort irgendwas "identifiziert" haben wollen...
Dass man jetzt irgendwo beim Faktor 20 mal sagt, dass man das aktuelle Verfahren aussetzt (nicht beendet) ist für mich nachvollziehbar und hat auch nichts mit "Leute im Stich lassen" zu tun.