Fusion: Stellarator (Wendelstein 7-X), Tokamak (ITER) & Andere
10.06.2025 um 02:35Richtig so....Wurstsaten schrieb am 06.06.2025:ITER & Co. denken nicht in MW/h
Genug Schwurbler sind eh schon unterwegs ;)
Richtig so....Wurstsaten schrieb am 06.06.2025:ITER & Co. denken nicht in MW/h
Version X..... "Jetzt geht's los"Peter0167 schrieb am 04.06.2025:sagen, wofür das X in der Bezeichnung steht?
Weder Wendelstein noch ITER sind dazu geplant einen Energiegewinn zu erreichen. Das sind reine Forschungsanlagen die den Weg zu kommerziellen Kraftwerken ebnen sollen.Wurstsaten schrieb am 06.06.2025:Fazit: Wendelstein 7-X ist ein Paradebeispiel für grundsolide Forschung, die sich als Kraftwerk tarnt. Und ITER? Ein Giga-Projekt ohne Exitstrategie. Wer wirklich an Energiegewinn glaubt, sollte nicht nach Greifswald oder Cadarache schauen – sondern vielleicht einfach zurück auf die Erde.
Ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass Wendelstein oder ITER primär dem Zweck eines Energiegewinns dienen sollen.alhambra schrieb:Weder Wendelstein noch ITER sind dazu geplant einen Energiegewinn zu erreichen. Das sind reine Forschungsanlagen die den Weg zu kommerziellen Kraftwerken ebnen sollen.
.
Dein Zeithorizont (20 Jahre bis zum Konzept, 40 bis zum Bau, 50 bis zur Skalierung) ist in der Sache vermutlich nicht falsch – aber er unterstreicht doch gerade, wie sehr diese Projekte gegenwärtig als Symbolpolitik herhalten müssen.alhambra schrieb:Das ganze wird etwa so verlaufen: in 20 Jahren werden wir wissen wie ein kommerzielles Kraftwerk aussehen muss. in 40 Jahren wird das stehen. Nach ein paar Jahren Testbetrieb und Optimierung wird man dann anfangen könne das ganze zu skalieren. Also so ums Jahr 2080 herum. Vorher wird es wohl nix werden.
Das las sich für mich so, da habe ich dir wohl unrecht getan.Wurstsaten schrieb:Ich habe zu keinem Zeitpunkt behauptet, dass Wendelstein oder ITER primär dem Zweck eines Energiegewinns dienen sollen.
Ja, da ist mir vor allem unser Bundeskanzler negativ aufgefallen, der im Wahlkampf so getan hat als wäre es bloss böser Wille das es noch keine Fusionskraftwerke gibt. Und ie ganzen Start-Ups die so tun als könnte man das in ein paar Jahren lösen.Wurstsaten schrieb:In Wirklichkeit geht es um Grundlagenforschung mit extrem langer Zeitskala – und sehr ungewissem Ausgang.
Das ist legitim, aber man sollte es dann auch ehrlich kommunizieren.
Ich bin durchaus ein Verfechter der Windenergie. Aber wenn wir irgendwann die Windräder wieder durch Fusionskraftwerke ersetzen könnte, dann fände ich das schon super.Wurstsaten schrieb:Was genau wollen wir denn 2060 oder 2080 mit einer Technik, deren Investitions- und Baukosten ein Vielfaches aktueller Alternativen betragen, deren Netzintegration komplex ist, und deren Skalierbarkeit bestenfalls vermutet wird?
Grundlagenforschung ist eh immer gut. Selbst wenn man nicht sagen kann wozu man es brauchen kann, irgendwann wird jemand kommen der es brauchen kann. Selbst wenn wir auf der Erde nie ein Fusionskraftwerk bauen werden, wer weiß denn ob wir das nicht in ein paar Jahrhunderten für Interstellare Raumfahrt brauchen.Wurstsaten schrieb:Dass die Grundlagen dafür jetzt erforscht werden, ist gut und wichtig
Das Grundproblem der Windenergie liegt in der geringen Energiedichte des Mediums. Wind liefert – verglichen mit fossilen oder nuklearen Quellen – extrem wenig Energie pro Quadratmeter. Das bedeutet: Um signifikante Mengen Strom zu erzeugen, braucht es eine enorme Zahl von Anlagen und eine massive Flächeninanspruchnahme.alhambra schrieb:Ich bin durchaus ein Verfechter der Windenergie. Aber wenn wir irgendwann die Windräder wieder durch Fusionskraftwerke ersetzen könnte, dann fände ich das schon super.
Aber um das akute Problem "Klimawandel" zu lösen, dafür kommt das alles zu spät. Das werden wir mit dem lösen müssen was wir jetzt haben.
Nein das Grundproblem liegt später imho:Wurstsaten schrieb:Das Grundproblem
Allerdings ist die Kapazität von Geothermie in Deutschland begrenzt. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann kann Geothermie etwa 10% des Strombedarfs decken.Wurstsaten schrieb:Trotzdem: In Bezug auf Versorgungssicherheit und Flächeneffizienz ist Geothermie jeder Windkraftanlage überlegen. Sie erzeugt auf kleiner Fläche viel Energie – und kann gleichzeitig für Heizung, Warmwasser und Stromproduktion genutzt werden.
Das kommt bei den Problemen noch oben drauf. Kein Schwein kann derzeit sagen was ne kwh aus nem Fusionskraftwerk kosten wird.abbacbbc schrieb:Bei Fission ist aktuell die Sicherheitstechnik, der treibende Faktor und bei Fussion wird es der Aufwand der Technik an sich sein, so dass am Ende eine mögliche Realisierung zwar möglich ist, aber zu einem sehr teuren Strompreis.
Das ist eine oft zitierte Zahl – sie bezieht sich aber meist auf die derzeit technisch und wirtschaftlich erschlossenen Potenziale. Das liegt weniger an geophysikalischen Grenzen, sondern eher an fehlender Infrastruktur, vorsichtiger Regulierung (wegen seismischer Risiken), und mangelndem politischem Willen.alhambra schrieb:Allerdings ist die Kapazität von Geothermie in Deutschland begrenzt. Wenn mich mein Gedächtnis nicht trügt, dann kann Geothermie etwa 10% des Strombedarfs decken.
Natürlich sollte man die Mitnehmen, denn 10% die wetterunabhängig zur Verfügung stehen sind gute 10%. Aber die Wunderwaffe ist es leider nicht.
Ja ???Wurstsaten schrieb:Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) schätzt das theoretisch nutzbare Potenzial der tiefen Geothermie in Deutschland auf rund 300.000 MWth – das wäre mehr als genug für eine vollständige Wärmewende und signifikante Beiträge zur Stromversorgung
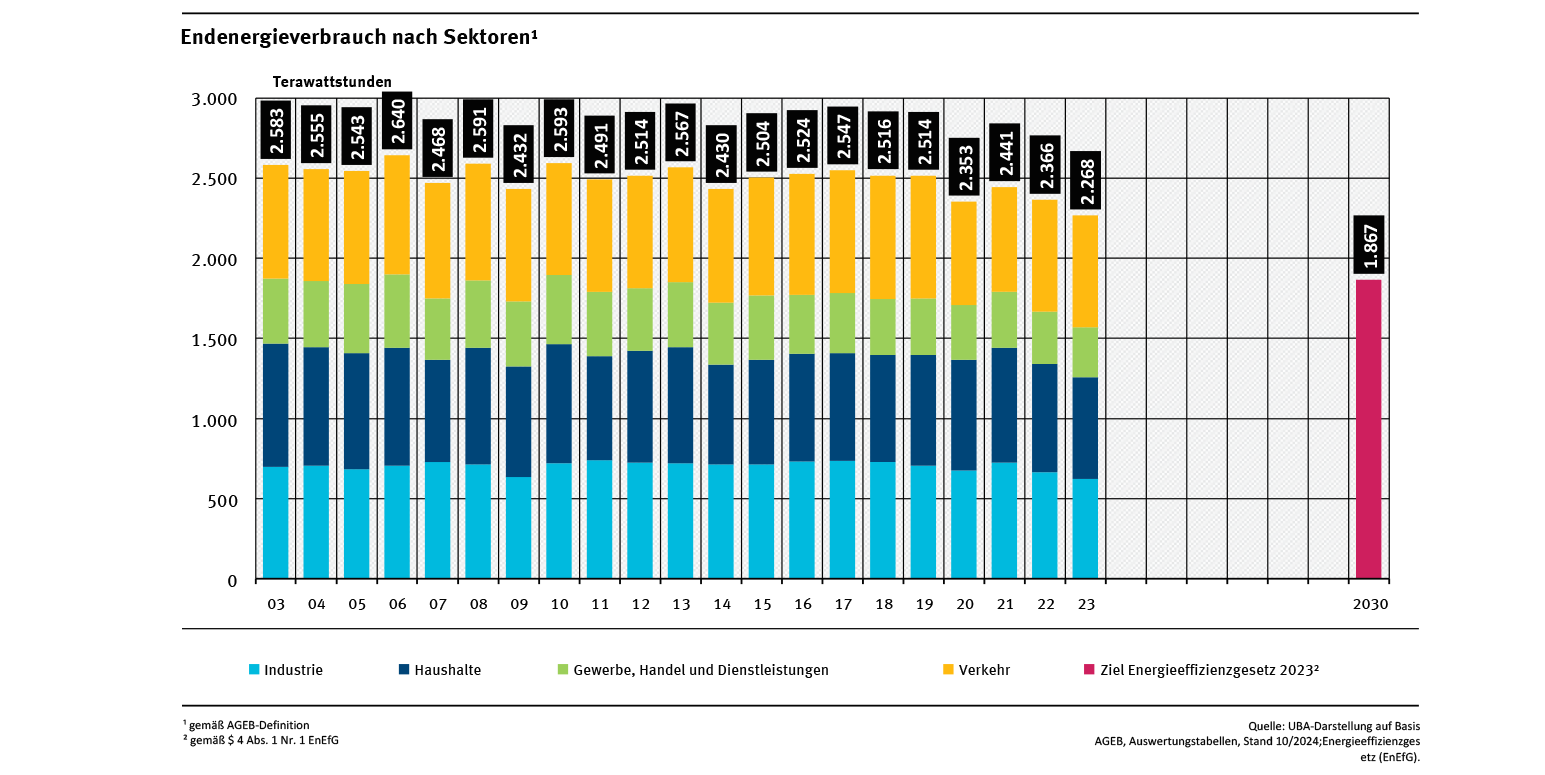
Also unwirtschaftlich passt das als guter Anteil. Wer zahlt???Wurstsaten schrieb:wirtschaftlich erschlossenen Potenziale
Nein, nein. Nicht TWh. 300GW thermische Leistung. Daraus kann man mit ordentlichen Dampfturbinen vielleicht 120GW elektrische Leistung rausholen. Wenn die Angaben von @Wurstsaten so korrekt sind, wäre das dicke ausreichend um den heutigen Strombedarf zu decken und für die Zukunft immer noch für gut die Hälfte des Strombedarfs ausreichend.abbacbbc schrieb:Baue deinen 300TWh da ein und sag welcher Bereich abgedeckt ist und für wen dann noch was übrig bleibt.
Ja, das ist wie immer die Frage. Ich kenne Preise um die 10ct die kwh. Aber wenn der Aufwand steigt, dann geht das auch schnell durch die Decke.abbacbbc schrieb:Also unwirtschaftlich passt das als guter Anteil. Wer zahlt???
Ahh sorry... Hatte die MW h.... Gesehen nicht MW thermischalhambra schrieb:Nein, nein. Nicht TWh. 300GW thermische Leistung
Das geht nur bei deutlicher Übertemperatur.alhambra schrieb:Daraus kann man mit ordentlichen Dampfturbinen vielleicht 120G
Jepp... 10ct/ kWh wo es lohnt ab in ein Netz mit 50% Beinverlusten und Verwaltung und der Kunde dankt für 20ct/kWh.alhambra schrieb:Ja, das ist wie immer die Frage. Ich kenne Preise um die 10ct die kwh. Aber wenn der Aufwand steigt, dann geht das auch schnell durch die Decke
Tatsächlich gibt es inzwischen interessante Weiterentwicklungen klassischer Geothermie: Einige Konzepte setzen auf überkritisches oder sogar flüssiges CO₂ als Wärmeträgermedium, anstelle von Wasser oder Dampf. Dabei wird CO₂ unter Druck in die Injektionsbohrung eingebracht, nimmt in der Tiefe Wärme auf und wird dann über eine Entnahmebohrung zur Stromerzeugung geleitet.abbacbbc schrieb:alhambra schrieb:
Daraus kann man mit ordentlichen Dampfturbinen vielleicht 120G
Du meinst vermutlich den Carnot-Wirkungsgrad, der den theoretisch maximalen Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine zwischen zwei Temperaturreservoirs angibt – unabhängig vom konkreten Prozess. Der Joule-Prozess (auch als Brayton-Prozess bekannt) ist das thermodynamische Grundmodell für Gasturbinen und Luftmotoren, aber nicht das Effizienzlimit.abbacbbc schrieb:Du kennst den Joule Prozess ???
Der zeigt den theoretisch maximalen Wirkungsgrad...
Nur zur Einordnung – bei einer heißen Quelle mit Thot = 200°C = 473 K und einer kalten Senke mit Tcold = 40°C = 313 K ergibt sich:abbacbbc schrieb:Schon aus ChatGPT kopiert ;)
Gib ein paar sinnvolle Temperaturen ein und schaue was aus den GWh th wird, wenn wir nicht sinnvolle Bereiche erschließen